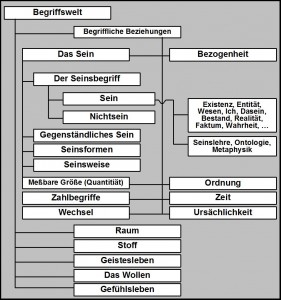R1 1
1. Teil
ABBEY ROAD
Protokoll Nr. 2
Insaße Nr. 4432 / 280147
Ich entere also nun wunschgemäß meinen Innenraum. Obwohl eine Situation eingetreten ist, die alles, was bisher von Bedeutung war, zunichte gemacht hat, ist das Tagebuch im Rucksack. Wenn man im fahlen Tageslicht darin blättert, lacht der Weggefährte, den man namenlos „Inder“ nennt: dass du dafür ein Kilogramm Mehl zurückgelassen hast! Für etwas, das wahrscheinlich nicht den nächsten Tag, auf keinen Fall aber die nächste Transition, in der die Welt wiedergeboren wird, überdauern kann!
Solange man lebt, antwortet man, werden diese Blätter an die Kindheit erinnern, so fern und so anders als heute. Wie die Mutter einen an sich gedrückt hat, der Vater einem die Hand hielt und wie sie dann zurückbleiben mussten, weil ihr Weg zu Ende war. Allein die Worte lassen im Kopf ein menschenwürdiges Dasein wiedererstehen, ohne moralisches Werturteil darüber, was getan wurde oder wie es hätte anders getan werden sollen.
Das verstehe ich schon, sagt er, gerade weil ich in meiner Kindheit dein menschenwürdiges Dasein gar nicht kennengelernt habe. Er kramt in seinen Sachen und holt ein rauchgeschwärztes Weberschiffchen hervor. Es war die Hölle (nach damaligen Begriffen, und selbst für Indien), erinnert er sich, beginnend im Alter von vier Jahren in einer finsteren heißen Kammer zu sitzen und Teppiche zu weben, tagaus tagein, ohne jede Aussicht, dass jemals etwas anders sein würde. Und doch sehne ich mich heute danach, wie ich spät abends, als sie die Tür aufsperrten, hinauslief, mich am Brunnen erfrischte, mich auf die Mauer des Marktplatzes legte und eine Zigarette rauchte. Über mir kreisten die Sterne, und ihre Schönheit übergoss meine Haut.
Man wagt nicht, obwohl es einen geradezu drängt, ihm die Hand zu reichen. Zu groß wäre das Gefühl der heutigen apokalyptischen Kälte gewesen.
—–
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sagte der Priester und schloß damit die Zeremonie. Er macht es sich leicht, dachte ich, indem er sich auf etwas beruft, was außerhalb unserer sinnlichen Wahrnehmung liegt. Als Sozialist, der seinen Marx noch nicht vergessen hat, neige ich natürlich dazu, solche Attitüden als Herrschaftsinstrumente zu interpretieren.
Das Grab, in das man unseren Freund gelegt hatte, stand noch offen. Christliche Symbole rundherum: wir wußten noch immer (und jetzt endgültig) nicht, wie er darüber wirklich gedacht hatte. Religion war, bei all dem Raum, den sie in seinem Leben einge-nommen hatte, eine der undurchsichtigsten Stellen seiner Persönlichkeit gewesen. Einige Leute weinten bei diesem Begräbnis, ich selbst stand nur da mit einem Gesicht, das schon keine Tränen mehr hatte. Sie, von der noch zu reden sein wird, stand neben mir und lächelte. Man muß wissen, daß dieses Lächeln damals fähig gewesen wäre, mein Funktionärsdasein durcheinanderzuwirbeln, hätte es nur mir gegolten. Ihr Lächeln, in dem die Melancholie über zwingend Geschehenes mitschwang, unergründlich für die meisten von uns Männern, erfaßte mich als Erschöpfung. Die Sehnsucht, die ich aus meiner pragmatischen Welt verdrängt hatte, sprang mich an: wenn ich doch gelebt hätte.
Ich bin der Thomas. Das Bild, das man sich jetzt von mir macht, entspricht allerdings nicht ganz meiner Wirklichkeit: so bin ich selten. Ich bin vielmehr daran beteiligt, die revolutionäre Idee – das Streben nach Glück – totzuorganisieren, und das Schlimme dabei ist, daß ich dabei nicht ganz so unglaubwürdig wirke wie andere. Was mich an meine zynischen Parteifreunde bindet, ist vor allem der Umstand, daß ich keine Alternativen finde. Das spielt aber jetzt auch keine Rolle mehr – ich muß die Beschränktheit meines Denkens durchbrechen, wenn ich die Geschichte meines Freundes erzählen will. Mit den mir eigenen Kategorien kann ich seiner Person keinesfalls gerecht werden, denn er hat unter diesen gelitten wie unter einer körperlichen Unzulänglichkeit. Was sollte er mit einem Funktionär anfangen, dem als Antwort nichts anderes eingefallen war, als in die innere Emigration zu gehen?
Man sagt, daß die Todesursache ein Herzleiden gewesen sei. Ich weiß aber, daß er systematisch gescheitert ist. Das sei festgehalten, um der Anschauung entgegenzutreten, daß einfach alles seine lapidar-körperliche Ursache habe. Der Tod besteht manchmal darin, dass das Leben mit seinen seltsamen Ansprüchen uns überfordert.
—–
Ich hatte Sonja Maria, die am Grab meines Freundes lächelte, kennengelernt, als ich in den Wohnblocks von Wien-Floridsdorf Mitglieder für die Partei werben wollte. Eigentlich aber sollten die Gespräche mit Zweifelnden mich auch selbst in Frage stellen. Es konnte ja gut sein, dass die Kaltschnäuzigkeit meiner Parteifreunde richtig und die Utopie ohnehin bereits zu Staub zerfallen war. In dieser Situation war es nicht unerheblich, die Bekanntschaft Sonja Marias zu machen.
Ich läutete an ihrer Tür, und als sie öffnete, sagte ich mein Sprüchlein auf. Sie lachte herzlich, ließ mich aber ein. Was soll man wirklich auf die Frage nach den Inhalten des Marxismus antworten als Funktionär einer Partei, die unter der Technik des kommunalen Wohnbaus und dem Volksfestcharakter des Ersten Mai verschüttet ist? Selbst wenn man in der Jugend abweichenden, von der Partei in die Illegalität gedrängten Strömungen angehört hat, schweigt man heute, den Ressentiments der Zuhörer gemäß, vom Kapitalismus, vom Eigentum an den Produktionsmitteln und besonders vom Klassenkampf. Man wagt nicht, vom Ziel zu sprechen, von der Gesellschaft, in der man ohne Gewalt zusammenlebt nach der Auflösung des herkömmlichen Staates.
Bei Sonja Maria brachte ich meinen Kanon dennoch vertrauensvoll vor, aber sie hatte andere Probleme: Sie hatte ein Verhältnis mit ihrem Chef, einem verheirateten Mann, der sich nicht von seiner Frau trennen, aber auch von ihr nicht lassen wollte. Angeblich konnte er sich als hoher Beamter eines Ministeriums keinen Eklat leisten, um seine bis dahin günstig verlaufende Karriere nicht zu gefährden, in der er sich einen Namen als Experte in der Verwaltung der Verstaatlichten Industrie gemacht hatte.
Und was soll man tun? fragte mich Sonja Maria. Ich fand in mir keine Antwort, auf keiner Ebene. Erstmals kam mir die unsinnige Ausschließlichkeit zu Bewußtsein, die von menschlichen Beziehungen gefordert wird, auch der Planungswahn, der uns bis in unser Gefühlsleben hinein verfolgt. Die Resignation, die mich bereits ergriffen hielt, wurde ganz konkret. Wir organisieren, wir regieren sogar. Eine Reihe von Genossen hält in Banken und Industrie Positionen, die ursprünglich dem Klassenfeind vorbehalten gewe-sen waren, und das Schlimmste ist: sie verhalten sich wie jeder beliebige Kapitalist. Das wiegt für mich schwerer als die Tatsache, daß sich an den ökonomischen Verhältnissen nichts geändert hat. Unserem Egoismus erlegen, tun wir nichts für die Veränderung des Bewußtseins. Die Hoffnungen sind uns fern, und das Ergreifen schwieliger Hände bei Betriebsbesichtigungen überbrückt die Kluft nicht.
Sonja Maria, intelligent, nicht unattraktiv, diffus unglücklich: was hatte sie von der Prognose des Marxismus? Das übliche Gerede eines Funktionärs, der sich einbildet, logisch zu denken, dessen Gedankenkette aber bereits jenes ultimative fehlende Glied aufwies. Ich sah plötzlich Dinge, die sich nicht einordnen ließen. Selbst wenn ich alles gewußt hätte, was Soziologie und Psychologie – durch die Bedürfnisse der Gesellschaft bis an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit getrieben – dazu sagen mochten: zu welchem Ende? Sonja Maria saß mir gegenüber und sah mich an. Mein Schweigen störte sie nicht. Sie wartete bloß, und es war ihr gleichgültig, allein oder in Gesellschaft zu warten. Mir war, als sähe sie durch meine äußere Hülle hindurch auf etwas Nichtssagendes: Ihr Kerle seid alle gleich, sagte sie ohne jede Bösartigkeit. Es ist sinnlos, euch hereinzulassen. Mich drängte es auf einmal, ihr zu sagen: Ich liebe Sie!
Eine unwillige Handbewegung: Machen Sie sich nicht lächerlich!
—–
Der Blick über die Brille, etwas spöttisch diesmal. Das wollte ich Ihnen auch gerade empfehlen, Themelis. So kann man doch heute nicht mehr erzählen! Wo sind wir überhaupt zeitlich?
1969/70, Herr Direktor. Ich kann zur Illustration eine Zeittafel vorlegen:
Und Sie glauben, dass dieses Tableau die 60er Jahre charakterisiert? Was ist mit der eigentlichen Studentenrevolte? Ich erinnere mich persönlich, wie man für den Sieg des Vietcong Partei ergriff, nicht für bornierte Hochschulreformen, sondern für allgemeingültige menschliche Interessen. Ich erinnere mich an die Auferstehung jener sozialistischen Ideen, die nicht zur Staatsdoktrin gefroren waren: Horkheimer, Trotzki, … Sie alle hatten lange Zeit auf ihr Publikum warten müssen, doch nun war es plötzlich da.
Sie wollen mir nicht weismachen, Herr Direktor, dass Sie selbst einst dabei gewesen sind. So sehen Sie, mit Verlaub, gar nicht aus.
Genau darum geht es, Themelis! Das Ärgernis von uns 68ern scheint es nachgerade zu sein, dass wir nicht nur unsere Standpunkte umgekrempelt haben, sondern vor allem unser Äußeres. Wir haben irgendwann begonnen, in einem anderen Körper zu wohnen. Bis zum heutigen Tag leben wir in einer permanenten Identitätskrise. Arrivierte Anwälte, Professoren, Politiker, Redakteure …
… Verleger …
Ja, zum Teufel, auch Verleger – alle fragen sich noch heute, ob sie ihre Jugend verraten haben, und fühlen den Zwang, sich immer aufs neue zu rechtfertigen. Vor allem das mit dem Körper ist wörtlich zu nehmen. 68 – das waren wuchernde Haare, Schweißflecken, befreite Busen, die Natürlichkeit schlechthin. Leider war vieles davon kein Aufstand gegen die Zivilisation, sondern auf das bloße Faktum der Jugend zurückzuführen. Folgerichtig hat uns die körperverändernde und -verhüllende Industrie mit fortschreitendem Alter zurückerobert.
Kann ich durchaus nachvollziehen, Herr Direktor. Wenn man (wie ich) etwas älter ist als Sie (das heißt als Existenzialist der frühen 60er Jahre) konnte man sich zwar die Identität des Bewusstseins bewahren, glaubte aber mit den Jahren, in der falschen Welt zu leben.
Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Themelis.
Darüber würde ich mir nicht übermäßig den Kopf zerbrechen, es sei denn, Sie wären an einem metaphysischen Rollentausch mit einem Ihrer Autoren interessiert.
Verwirrt nimmt der Verleger die nächsten Blätter zur Hand.
—–
Als Johannes mit etwa acht oder neun Jahren auf einem Ruinengrundstück an der Alten Donau spielte (der Bombenkrieg hatte den Kindern romantische Indianer-Jagdgründe beschert), kannte ich ihn noch nicht. Dafür mochte er dort an der Straße manchmal Sonja Maria begegnet sein, die verträumt von der Schule nach Hause ging. Einmal stolperte Johannes bei einer Verfolgungsjagd und stürzte vor Sonja Marias Füße. Sie wusch am Hydranten mit ihrem Taschentuch seine Wunde. Dann begleitete sie ihn nach Hause: er wohnte mit seinen Eltern in einem der durcheinandergewürfelten Einfamilienhäuser, die heute – zusammen mit dem „Jagdgebiet“ – längst einem System von Gemeindebauten Platz gemacht haben.
Sicher hatte Johannes auf dem Heimweg Angst vor der Reaktion seiner Mutter, wie stets, wenn etwas Außergewöhnliches geschehen war (die egozentrische Gleichgültigkeit, die sein Vater zur Schau trug, war damals wesentlich bequemer für ihn). Eine Kritik an Johannes‘ Eltern ist schwer anzubringen, denn materiell fehlte es ihm an nichts von dem, was damals Standard war. Ohne Zweifel äußerten sich bei ihm frühzeitig schöpferische Fähigkeiten, die allerdings daheim auf deutliches Unverständnis stießen. In einem Gespräch, das Johannes eines Tages zufällig mithörte, bezeichnete sein Vater sogar den stark ausgeprägten Hang des Sohnes zum Lesen als recht unerfreulich.
Man wollte – und ich sage das mit einem sehr gedämpften Zynismus – sein Bestes. Man versuchte, ihn vor allen widrigen Um-ständen zu bewahren und seine Entwicklung ruhig und gleichförmig zu gestalten. Die Eltern hatten beide Weltkriege erlebt und eine Art Jugend dazwischen: immer war alles anders gekommen. Dem Sohn gewisse Erfahrungen ersparen zu wollen, war ebenso gut gemeint wie undurchführbar.
Die utopischen Romane, die er gerne las, lösten in ihm etwas aus, was man ästhetischen Schauer nennen könnte, und ich verstand erst sehr spät, dass er deshalb kein praktischer, sondern ein sozusagen phantastischer Sozialist wurde: der die Unterdrückung vor allem als hässlich empfand. Der faktischen Schuldisziplin unterlag er mit heftigen geistigen Krämpfen in einer Umgebung, in der die Einebnung von Begabungen unausgesprochenes Prinzip war. Ich selbst habe im Bewusstsein dessen mit großem Eifer an Reformplänen für dieses Schulwesen mitgearbeitet, bis höhere Funktionäre die Notbremse zogen: ihnen war plötzlich bewusst geworden, dass der zum Denken erzogene Bürger eine eminente Bedrohung für den Parteienstaat darstellen würde.
Gegen Ende reagierte Johannes auf die lustverachtende Schule, indem er sie teils ignorierte, teils ironisierte, und geriet dadurch sogar auf einen gefährlichen Pfad, da die Autorität ihren Weg durch die kleinsten Ritzen findet, um sich in uns festzusetzen, aber eben unmerklich. Auf diese Art kann man die nicht kennenlernen, geschweige denn bekämpfen, die unsere Entscheidungen manipulieren.
Dass mein späterer Freund in diesem Alter manchmal an Selbstmord dachte, besonders dann, wenn eine seiner bittersüßen Liebesgeschichten in die Brüche gegangen war, halte ich für weniger bemerkenswert. Der Versuch, das Innere ohne Übertragungsverluste nach außen umzusetzen, kann natürlich zu argen Enttäuschungen führen: noch dazu in jenen Jahren, in denen die bürgerliche Jugend auf ein versteinertes System mit nichts anderem als Nihilismus reagieren konnte. Viele waren von dieser Todessehnsucht erfasst, die aus der Konsumgesellschaft erwuchs: aus dem Bewusstsein, dass das Wachstumsgebäude ganz pietätlos auf dem Schindanger des Holocaust errichtet worden war. Spröde Küsse, ein wenig Petting einerseits, andererseits das superblonde Zahnpastalächeln und die üppigen Illustriertenbilder als ganz verdinglichte Fassade der Erotik.
—–
Das hatte schon in den späten 50er Jahren begonnen, Themelis – bereits als Kind habe ich das begriffen. Der Luxus, der Sex, der Optimismus, den der Starkult zur Schau stellte, war schließlich eine Propagandawaffe des Kalten Krieges gegen die kommunistische Ideologie der bloßen Verheißungen. Man sah Marilyn Monroe an ihrem Swimmingpool, auf der Yacht ihres Produzenten: man hatte die Illusion, an ihrem Leben teilzuhaben. Es war das genaue Gegenteil der späteren virtuellen Welt. Die Politik war in dieses Geflecht durchaus einbezogen: Präsident Kennedy ohne seine Jackie – undenkbar. Und doch fragen wir uns heute fast, ob sie alle wirklich gelebt haben.
???
Und immer sauber. Denn alles, was diesen Anschein hätte trüben können, wurde nicht berichtet. Die Klatschspalten dieser Zeit beachteten strenge Tabus. Dass John F. auch mit der Monroe etwas hatte und nicht jeden Abend bei seiner schönen Frau verbrachte, tuschelten Wissende, aber sie schrieben nicht darüber. Diese High Society wurde niemals als Sündenbock für irgendetwas missbraucht (im Gegensatz zu den 68ern), obwohl niemand leugnen wird, dass unsere Bewegung einen unzweifelhaften Beitrag zur Modernisierung geleistet hat.
???
Bleibt also die Schlussfolgerung, dass jemand die ganze Modernisierung durchaus nicht haben möchte. Was macht man aber mit etwas Missliebigem? Will man elegant sein, vereinnahmt man es einfach: wir älter gewordenen 68er stehen heute Seite an Seite mit den anderen Vertretern der Gesellschaft, werden zu Talksendungen des Fernsehens eingeladen, geben dumme Antworten auf dumme Fragen, sind als Identität verschwunden.
???
Wie bei jeder Revolte besteht die besondere Tragik darin, dass der eine oder andere ihrer Träume in der Praxis als haarsträubende Parodie oder als schrille Farce gespielt wird, und wie die Schauspieler das merken, versuchen sie sich von der Bühne fortzustehlen. Aber Sie wissen ja, Themelis, aus diesem Etablissement kann sich niemand lebend davonmachen.
Können wir jetzt fortfahren, Herr Direktor?
—–
Pressluftmeißel rissen den Asphalt auf. Ihr Getöse begann um 7 Uhr 15 vor Sonja Marias Haus. Auf dem Weg zur Arbeit ging sie an den Arbeitern vorbei. Sie wusste, dass sie wieder einmal zu spät kommen würde. Der Lärm war noch zu hören, als sie an der nächsten Ecke die Straßenbahn bestieg, und er erinnerte sie an die Kindheit im Krieg (eine für sie typische Assoziation an einem strahlenden Sommermorgen): die Flucht mit der Mutter und den Geschwistern irgendwoher irgendwohin, der Handwagen mit den angesichts der Situation eher seltsamen Habseligkeiten, die Hoffnung, heil durch-zukommen. Die Front verlief ganz nahe, mitten durch die Stadt, und alles war unerträglich laut: die Sonne dieses Frühlings schrie, die Wolken brüllten. Und dann war alles ganz schnell vorbei, man konnte zu-rück in die Wohnung oder was davon übriggeblieben war, der Vater war eines Tages wieder da, aber er war ein ganz Fremder geworden. Und jahrelang mahlten sich die Panzer der sowjetischen Besatzungsmacht durch die Straßen. Sie rissen das Pflaster auf, wenn sie vom alten Bahnhof Floridsdorf herunterkamen.
Die Leute in der Straßenbahn sahen Sonja Maria nach, als sie im Mittelgang des Waggons nach vorne ging. Sie trug ein kurzes buntes Kleid, das ihre schlanke Gestalt sehr zur Geltung brachte. Manch einen mochte sie an ein Jugendbildnis der eigenen Mutter erinnern, irgendwie zeitlos. Sie war von einer eher herben Schönheit, sodass ein Mann sie wohl hundertmal hätte fotografieren können im Versuch, dieses Phänomen festzuhalten. Aber an so etwas dachte Sonja Maria jetzt nicht (bemerkte auch nicht die Blicke der Leute).
Die Haltestelle kam unvermittelt. Sonja Maria stieg aus und kaufte eine Zeitung. Sie überflog die Schlagzeilen, die ihr keinen wirklichen Sinn zu ergeben schien, aber doch ganz praktisch waren: Stoff für Diskussionen im Büro und im Bekannten-kreis, ganz praktisch, weil man das Gespräch nie zum Wesentlichen vordringen lassen musste. Dazu das Fernsehen, das erfolgreich begann, längst fällige Gespräche zwischen Familienmitgliedern auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Sonja Maria wusste von ihrem vorgesetzten Freund, dem Regierungsrat, der seit gut zwanzig Jahren verheiratet war, wie leicht es ihm fiel, sein Desinteresse für Frau und Sohn hinter TV-Magazinen, Sportübertragungen, alten Filmen und Musik-Shows zu verbergen, besonders am Wochenende, der heikelsten Phase der modernen Familie.
Sonja Maria selbst kannte ihren Mentor damals seit sechs oder sieben Jahren, praktisch seit ihrem Eintritt in das Ministerium, wo er sich von Anfang an ihrer an-genommen hatte. Trotz ihrer Mängel in bürotechnischen Fähigkeiten entwickelte sie sich unter dieser Schutzherrschaft zu einer geachteten Mitarbeiterin, ließ daneben viele Gelegenheiten scheitern und vermied es geflissentlich, jemanden wirklich näher kennen zu lernen. Aber auch ihrem Chef entglitt sie mit der Zeit und wurde ihm als Ganzheit immer unzugänglicher. Sie spielte ihre Rollen in mehreren Leben, ohne bestimmte Anhaltspunkte ganz zu verlieren: so etwa die Beziehung zu ihrem Vater (die Mutter war inzwischen gestorben), der bei ihr wohnte und für den sie allein sorgte, nachdem ihre Geschwister eigene Wege gegangen waren. Er war von Beruf Werkzeugschlosser, schon im Ruhestand, als ich Sonja Maria kennenlernte ein unbelehrbarer Nationalsozialist, Hundeliebhaber und noch viel mehr. Sein Gedankengut drängte sich in täglichen fruchtlosen Gesprächen unaufhaltsam in Sonja Marias Bewusstsein, trotz aller Widerstände, und es bedurfte oft langer einsamer Spaziergänge, um in dieser Vorhölle überhaupt bestehen zu können. Das Erlebnis beim „Jagdgebiet“ lag schon weit zurück und war vergessen. Ein neuerliches Zusammentreffen mit Johannes stand erst bevor.
Sonja Maria betrat schließlich das alte Gebäude in der Wipplingerstraße, in dem die Dienststellen mehrerer Behörden untergebracht waren. Die zehn Minuten Verspätung bedeuteten für sie gewonnene Zeit, die sie dem höchst langweiligen Büroalltag abgerungen hatte. Immerhin war sie noch vor dem Regierungsrat eingetroffen, sodass sie sich nicht einmal eine Entschuldigung einfallen lassen musste, wie er sie normalerweise als Anschein von Korrektheit von ihr verlangte. Sie setzte sich an ihren Platz und begann, die Post vorzubereiten. Als sie ihrem Chef die Mappe vorlegte, teilte er ihr mit, wann er in dieser Woche Zeit für sie haben werde, und sie versprach, die entsprechenden Abende freizuhalten. Es änderte sich nichts, und nichts wurde klar.
—–
Hoffentlich nimmt sich nicht das Literarische Quartett Ihres Textes an, Themelis, wenn – ich sage wenn – ich ihn veröffentliche. Dann gehen wir nämlich unter!
???
Wissen Sie nicht: Reich-Ranicki und seine Gesprächspartner?
???
Verstehen Sie nicht? Diese Fernsehsendung ist eine Verkaufspromotion! Eine lobende Erwähnung von Reich-Ranicki ist gleich 50.000 verkaufte Exemplare. Oder eben das Gegenteil: Sie können sich vorstellen, was minus 50.000 für Ihr Buch bedeuten würde, da könnte es gar nicht zu existieren beginnen!
Aber ich kenne diese Leute nicht.
Themelis, Sie reiner Tor! Das sind Wegmarken auf der breiten Straße der zuletzt siegreichen westlichen Demokratie. Jetzt kann alles dem Markt untergeordnet werden, genau das, was den Kapitalismus-Kritikern aller Schattierungen als Horrorvision erschien – die vollends eindimensionale Welt. Obwohl in den 60er Jahren auch der Sowjet-Mythos total abgewirtschaftet hatte und obwohl die stalinistischen Ideologen sich instinktiv gegen die (für sie unkontrollierbare) Jugendbewegung stellten, fungierte die UdSSR noch immer als einziger Platzhalter einer Alternative zum amerikanischen Weg. Vollends das China der Kulturrevolution bot sich aus demselben Grund als das Gelobte Land der Revolution an, obwohl dort nichts anderes geschah, als dass sich ein greiser Diktator mit Hilfe von Terrorbanden noch einmal gegen seine Rivalen durchsetzte.
Aber ist nicht Amerika vielmehr den Faschisten als den Linken ein Greuel? Schließlich wurde am D-Day, als 1944 westalliierte Truppen in der Normandie landeten, die frühere, kaum jemals in Zweifel gezogene Identität Europas rechts und ganz rechts mit wuchtigen Liberalisierung- und Demokratisierungsschritten zertrümmert.
Und dennoch wählte Amerika in seiner Frontstellung gegen die andere Supermacht selbst den faschistoiden Weg, und zwar in einer womöglich gar nicht reversiblen Form. Marktwirtschaft bedeutet heute nicht mehr relativ wenige ordnungspolitische Eingriffe, sondern freie Durchsetzung der Gier. Die USA haben damit den Boden des traditionellen Politikschemas verlassen. Newt Gingrich, der Prophet der Republikanischen Partei in den frühen 90ern, war kein Wertkonservativer, sondern eine Art Sozialrevolutionär mit umgekehrtem Vorzeichen: ein Anarchist von oben, der alles spezifisch Menschliche zerstören wollte, das sich der totalen Kapitalakkumulation entgegenstellt. Da ist natürlich etwas hängen geblieben.
Und was hat das mit mir zu tun, Herr Direktor?
Ein gieriger Verleger, Themelis, wird sich ihr Buch (soweit ich es bis jetzt kenne) nicht einmal anschauen, geschweige denn veröffentlichen. Ein gieriger Zeitungsmensch wird es nicht rezensieren, ein gieriger Fernsehintendant wird es in keiner seiner quotensüchtigen Sendungen vorstellen. Der Marktanteil dieses Textes ist unter diesen Umständen null, schon gar wenn ich folgendes Gedicht ansehe:
—–
AUS DEM LITERARISCHEN WERK DER AMÉLIE N. ALIAS „AGENT DREAM“
Dokumente einer möglichen Existenz
Hrsg. von Claudia Th. unter sorgfältiger Bearbeitung
Äther
Paradiese im Augenblick / Anita
Anschluss und Ausbesserung / Leere
Rekruten erschossen
Die Nacht der Gummiknüppel
Sozusagen und Schaden / kostbare Eigenheit
Vermögen
und Vergessen
und unschuldig
Oben also… / Duell der Konflikte
Markantes Blau
Die zweite Sorgfalt
… oranges Ende
Aus dem Band „Grundsätze“
—–
Diese Texte sind, ich kann es nicht oft genug wiederholen, nicht von mir,.
Aber das hier ist nicht prinzipiell schlecht. Es bringt mir nur keine Lesermassen. Ihr eigentlicher Text übrigens auch nicht!
Lassen Sie doch das Werk sich entwickeln. Man muß Zeit haben, man muß sich das Geschriebene lesend erarbeiten. Wenn man ihm keine Zeit gibt, Assoziationen hervorzurufen, die Zeichen seiner Unausschöpfbarkeit sind, wird es natürlich flach und unscheinbar wirken!
Persönlich verstehe ich Sie ja, Themelis, aber denken Sie an die Konkur-renz! Wir leben schon geraume Zeit in einer Welt, in der Sie das Stöhnen einer Liebesnacht aus dem Radio hören können!
Eine gute Idee, Herr Direktor. Die beiden Interpreten passen gut ins Zeit-bild…
… Jane Birkin und Serge Gainsbourg, wenn ich mich richtig entsinne…
Sie haben ein ausgezeichnetes partikulares Gedächtnis!
—–
Der Autobus fuhr den Damm entlang in Richtung Venedig. Sonja Maria kniete auf der hintersten Sitzbank und sah zum Heckfenster hinaus. Die jungen Männer winkten einer Autofahrerin zu, die nicht zu überholen wagte. Mehrere andere Fahr-gäste dösten vor sich hin, von der Tages-reise ermüdet. Ein Zug fuhr auf der Bahntrasse vorbei. Auf der Lagune schwammen Boote. Johannes sah Sonja Maria immer wieder an, aber es war sicher kein Wiedererkennen. Seine Blicke glitten langsam über ihre Gestalt, blieben da und dort haften, an ihrem Gesicht, an ihrem Busen, an ihren Knien. Auch sie betrachte-te ihn dann und wann aus den Augenwin-keln. Als er sprach, drangen seine Worte nicht durch den Wall ihrer Träume, sie sah nur, wie er die Lippen bewegte. Schließ-lich wandte er sich wieder dem Seiten-fenster zu.
Damit ging der zweite Tag der Italienreise, die Sonja Maria und Johannes zufällig zusammengeführt hatte, zu Ende. Ein wirklicher Kontakt zwischen beiden ergab sich erst später, als die Reisegesellschaft die Basilika Sant’Appollinare in Classe besuchte. Es begann zu regnen, und Johannes suchte sich in das Gebäude zu retten, doch das Gedränge war zu groß. Sonja Maria hielt wie selbstverständlich ihren Schirm über ihn. Er ergriff ihren Arm und fühlte eine leise Abwehrreaktion, die er allerdings nicht sonderlich beachtete. Sie betraten schließlich die Kirche und Johannes punktete ein wenig mit dem exotischen Flair gymnasialer Allgemeinbildung.
Am nächsten Abend kamen sie in Rom an. Von der sinkenden Sonne rötlich gefärbter Dunst lag über den Dächern. Der Chauf-feur brauchte lange, um das Quartier zu finden, ein Klosterhospiz in der Via Casili-na, und so sahen sie bereits einen guten Teil der Stadt, kamen an Gärten vorbei, an Palästen, Villen, Häusern, Kirchen. Sie fuhren durch Straßen, deren Namen den gewissen Klang hatten, in jener Sprache, die Johannes auf der Zunge zerging: Rom – Roma.
Dann begann alles. Durch ein Gewirr von Dunkelheit und Licht, kühlen Springbrun-nen und heißen Mauern, hohem Himmel und schwerer Luft in den Gassen gingen Sonja Maria und Johannes. Sie erlebten Rom auf dem Monte Pincio, in einem Eis-salon bei der Fontana di Trevi, auf der Piazza di Spagna, in der Via Veneto. Sonja Maria sah den eleganten Damen nach, deren Lebensinhalt sich nur schwer erah-nen ließ. Bei Johannes zuckte die Er-kenntnis durch den Kopf, daß er das Zeug in sich hätte, eine von denen zu haben. Dann aber löste sich für ihn rasch und ohne Nachgeschmack auf, was er irgend-wo zurückgelassen hatte. Als sie mit dem städtischen Autobus von Termini nach Hause fuhren und ganz eng beieinander saßen, hätte diese Fahrt ewig dauern können (na ja, das sagt sich so). Beide zitterten irgendwie davor, den esoteri-schen Mantel der neuen Liebe wegzureißen und ihre Beziehung auf ein mehr phy-sisches Gebiet voranzutreiben. Beiden wurde der frühere Verlust der Unschuld schmerzlich bewußt, die man dann und wann gerne wieder hätte, selbst wenn man nicht gezögert hat, sie zu verlieren.
Sie machten kein Licht auf Sonja Marias Zimmer, denn die helle Finsternis kam ohnehin beim Fenster herein: nicht zur Ruhe geschaffen. Man kann im Espresso diskutieren, Rotwein trinken bis zur Be-wußtlosigkeit, nur nicht ausruhen in der römischen Nacht, es sei denn man wäre tot. Es gab kein Zeitgefühl für Johannes und Sonja Maria, die Uhren tickten ir-gendwo abseits, und irgendwo abseits war Weltgeschehen. Mit den Fingerspitzen zeichneten sie gegenseitig die Konturen ihrer Körper nach und erfaßten langsam die neue Dimension: eine eigenartig neue Perspektive, in der die Sterne ganz nahe an ihnen vorbeiflogen, grünflackernde Al-leebäume ein Spalier bildeten und uralte Gebäude sie ehrfürchtig umstanden. In dieser Landschaft fehlten in diesem Au-genblick die Kulissen der Vergangenheit. Johannes zerstörte die Stunde nicht, ebensowenig tat es Sonja Maria. Sie spra-chen mit Küssen und Berührungen, flüs-terten allenfalls ihre Namen. In dieser Si-tuation subjektiver Wahrheit schienen die Gesetze nicht mehr zu gelten, die da lau-ten: Einsamkeit ist das Dauernde, Arbeit das Bleibende, Pflicht das Beständige.
—–
In diesem Sinne hat Johannes mir damals aus Italien geschrieben, und ich belächelte seinen Brief nicht. Die Verwendung des Begriffes subjektive Wahrheit machte mir klar, daß er die Dinge ehrlich sah. Sonja Maria, an die ich mich bei Nennung des Namens sofort erinnert hatte, mochte das gleiche wie Johannes erlebt haben, er mochte vielleicht dieses Wunder vollbracht haben. Sicher sprach einiges für seine Wirksamkeit: daß er jünger war als sie, große staunende Augen hatte; daß er sich positiv abhob vom Regierungsrat, dessen leichter Fettansatz und vor allem alkoholdunstender Atem nach einigen Stunden beim Heurigen schon manchmal kritische Distanz bei Sonja Maria erzeug-ten. Dennoch wußte Johannes nicht, wo-gegen er antrat, konnte nicht ahnen, wa-rum über Einzelheiten nicht gesprochen worden war. Und denkt man an Einsam-keit, Arbeit und Pflicht, und sei es unter dem Gesichtspunkt aufgehobener Gesetze, wenn man die glückliche Nähe einer Frau erlebt hat? War es vielleicht so gewesen, daß sie ihn trotz aller Euphorie gebeten hatte, beim Geschlechtsverkehr aufzupassen? Das hätte natürlich seinem kindlichen Idealismus einen Schlag ver-setzt, zumal er die Tendenz hatte, allem eine elementare und endgültige (kategori-sche) Bedeutung beizumessen. War wo-möglich (das fragte ich mich schließlich ernsthaft) in jener Nacht in Rom über-haupt alles danebengegangen?
Sollte es eine Krise gegeben haben, hat Johannes sie zweifellos in seiner unver-wechselbaren Art überspielt. Mit der ihm eigenen Naivität übte er einen seltsamen Reiz auf bestimmte Frauen aus, die sich berufen fühlen, einen Traurigen zu trösten. Sonja Maria kämpfte gegen die Stimme in ihrem Inneren, die Johannes abwehren wollte, versuchte ihn anzuerkennen über ihre Erfahrungen mit ihrem väterlichen Freund hinweg. Von dem, was sich in seiner Reisegefährtin abspielte, merkte Johannes sicher nicht viel. Er staunte bestenfalls darüber, daß sie manchmal extrem schweigsam war. Schlafwandlerisch plauderte er über solche Klippen hinweg, und an Gesprächsstoff – belehrend und unterhaltend aus dem Fun-dus seiner bürgerlichen Bildung – fehlte es ihm wahrlich nicht. Wenn er fühlte, daß ein Gespräch über zentrale Anliegen nicht möglich war, wechselte er äußerlich ganz leicht auf ein anderes Thema über, und er versäumte damit – um bei seiner Termino-logie zu bleiben – die Möglichkeit, der ob-jektiven Wahrheit auf die Spur zu kom-men: daß er ein von Sonja Marias Dasein völlig verschiedenes Leben führte.
Und anders als meines, muß man hinzufü-gen. Wegen der starken Aktivität, die da-mals sowohl von meiner Partei als auch vom ganzen politischen System ausging, hatte ich Sonja Maria und Johannes vor ihrer Italienreise ziemlich aus den Augen verloren, und doch mußte ich über beide viel nachdenken: die Prototypen der Wechselwähler, wie ich sie insgeheim nannte.
Unsere Partei aß damals das trockene Brot der Opposition. Dabei waren unterschied-liche Phänomene zu beobachten, die ent-sprechend heftig diskutiert wurden: vor allem daß der Mangel an Macht die Partei personell aushöhlte. Viele blieben weg, die normalerweise beigetreten wären, um sich berufliche oder sonstige Vorteile zu ver-schaffen. Nicht weniger Leute kehrten uns den Rücken und nahmen das Mitglieds-buch der Regierungspartei, um ihre Karri-ere nicht stocken zu lassen. Die Ära der Großen Koalition hatte in den Gehirnen tiefe Spuren hinterlassen, und es gab Funktionäre, die für eine fortgesetzte Ko-operation mit dem ehemaligen Koalitions-partner eintraten, um über die Möglichkeit pragmatischer Postenbesetzung im öffent-lichen Bereich wieder Mitglieder anzuzie-hen. Andere, zu denen ich mich damals zählte, vermerkten positiv, daß diejenigen, die bei uns ausharrten, wenigstens einen Rest innerer Überzeugung aufwiesen. Wir waren nicht so klein, daß man von einer Katastrophe sprechen konnte, und so hatten wir die Chance, nach dem Fortfall der Versu-chungen ideologisch schlagkräftiger zu werden. Der Ansatz, über eine Weiter-entwicklung und Anpassung der marxisti-schen Grundlagen an die Gegebenheiten einer neuen Zeit das gesellschaftsverän-dernde Ziel nicht aus den Augen zu verlie-ren, setzte sich zwar nicht durch, aber auch die Steigerung des Lebensstandards und die Freiheit zum Konsumieren unge-hindert von den bisherigen ethischen Schranken wurde noch nicht die offizielle Parteilinie.
—–
Johannes kam von Italien zurück, und ich sah ihn wieder öfter. Er erzählte mir nichts mehr von Sonja Maria, bis ich ihn eines Tages fragte, aber er wußte nichts von ihr. Es stellte sich heraus, daß es für sie in Wien keineswegs selbstverständlich war, weiter mit ihm zusammen zu sein. Sie ganz einfach anzurufen oder zu besuchen, kam ihm nicht in den Sinn, dazu war offenbar der Zustand des Leidens – er-satzweise für die Erfüllung – zu süß. Erst als er die Angebetete zufällig auf der Stra-ße traf, kam es zum Wiederaufleben ihrer Beziehung, zu einer Renaissance, wie Jo-hannes es nannte, und als ich diesen Be-griff hörte, verstand ich die Empfehlung Henry Millers, die berauschten Freunde zu trösten.
Die beiden gingen damals Tag für Tag miteinander aus, und bei Johannes sam-melten sich eine Menge der von ihm so geschätzten Relikte wie Straßenbahnfahr-scheine, Kino- und Theaterkarten, Kaffee-hausrechnungen und dergleichen. Hie und da zog er diese lächerlichen Papiere aus der Tasche, erzählte die dazugehörigen Geschichten und kam gar nicht auf die Idee, wie sehr er mich damit nervte. Ich fragte mich ohnehin, wie lange Sonja Ma-ria das mitmachen werde: in ständiger Konfrontation mit einer ihr teilweise un-verständlichen oder wenigstens schwer zugänglichen Persönlichkeit. Ich fragte mich weiters immer dringender, ob Jo-hannes bis dahin überhaupt jemals mit ihr geschlafen hatte, nicht weil ich es für ab-solut notwendig hielt, aber doch jedenfalls nicht für unwesentlich, und ich war ge-neigt, die Frage zu verneinen, besonders dann, als Sonja Maria meinem berauschten Freund mitteilte, daß er sie nicht wie-dersehen werde.
Er sagte ihr trocken Lebewohl und sah schweigend zu, wie sie die Tür aufschloß und das Haus betrat. Er ließ sein Auto, wo es war, und ging den Weg an der Alten Donau entlang. Eine alles umfassende Gleichgültigkeit hielt ihn in seinem Inners-ten abgetrennt von allen peripheren Er-schütterungen. Wieder stieg – aber das ist jetzt meine distanzierte Interpretation – die bittere Süße des Leidens aus dem Ur-grund auf. Johannes dachte an Gershwins Porgy and Bess, das sie an diesem Abend in der Volksoper gesehen hatten (die Ein-trittskarten trug er noch bei sich), dann an das Gespräch mit dem Titelhelden, der ebenfalls ins nahegelegene Restaurant gekommen war und an ihrem Tisch Platz gefunden hatte. Erst als Johannes dann in plötzlich durchbrechender Verzweiflung zu Hause alle Türen, die er benützte, mit lau-tem Krach ins Schloß warf und seine aus dem Schlaf gerissenenen Eltern ihn ent-geistert anstarrten, wurde ihm der ganze Tatbestand bewußt. Er verfaßte einen Brief an Sonja Maria (in dem er sich aller-dings nicht als Fordernder präsentierte) und wartete in den nächsten Tagen auf Antwort. Nach drei oder vier weiteren Briefen kamen einige Zeilen von Sonja Maria mit einer Entschuldigung, um die er nicht gebeten hatte.
Für mich als Außenstehenden war die Bitte um Verzeihung weniger abwegig als für Johannes, denn ihn zu verletzen, war tat-sächlich nicht Sonja Marias Absicht gewe-sen, nur wußte sie eben nicht mit ihm um-zugehen, und das hatte noch nicht einmal mit ihrem eigentlichen Freund zu tun. Bei mir ging Johannes damals aus und ein, erzählte immer wieder dieselben Dinge und erwartete von mir nichts, als daß ich ihm zuhörte. Seine äußere Erscheinung verwahrloste, und ich stellte fest, daß er ziemlich unmäßig trank. Hätte Sonja Maria ihn so gesehen, wäre sie in ihrem Ent-schluß, der darauf beruhte, daß Johannes nicht zu ihr paßte, nur bestätigt worden: und das ohne Verwechslung von Ursache und Wirkung, würde ich sagen.
Ich arbeitete gerade wieder einmal an einem Memorandum über die Reform des Erziehungssystems und hielt mich in mei-nen Formulierungen bewußt zurück. Ich hatte in Johannes immerhin einen aktuel-len Extremfall vor Augen: seine aufgrund von Unwissenheit und Zwang verklemmte Reaktion auf zwar irrational erscheinende, aber doch vorhersehbare Ereignisse. Jo-hannes fragte mich gar nicht nach meiner Meinung, denn er hatte nur ein klar fest-gelegtes Ziel: Sonja Maria wiederzugewin-nen. Trotz meiner Skepsis gegen dieses Vorhaben, ein womöglich noch gar nicht Besessenes zurückzuholen, beneidete ich meinen Freund irgendwie um seine Kon-sequenz. Im öffentlichen Leben entstand damals gerade jenes Kompromißlertum, das dann ab den siebziger Jahren seine Hochblüte erleben sollte. Jedermann be-gann, sich mit seinem eigenen Standpunkt amöbenhaft an jenen des anderen anzu-schmiegen, Hohlräume geschickt auszufül-len, Kanten und Profile ängstlich zu um-wabbeln. Wie Johannes reagierte, das konnte man eine Sache wichtig nehmen nennen. Ich fragte mich, ob ich selbst we-gen irgendetwas in eine derartige Grenzsi-tuation verfallen konnte, und erkannte, daß es in meinem Leben bis dahin nie ei-nen vergleichbaren Anstoß gegeben hatte. Ich kam schließlich dahin, das Verhalten meines Freundes irgendwie zu bejahen. Worauf soll unsere Selbstachtung denn letztlich beruhen? Auf der Anerkennung von Personen vielleicht, die sich ungebe-ten zu unseren Beurteilern machen? Oder doch vielleicht auf der Zustimmung derer, denen wir uns freiwillig öffnen?
Was nützte es Johannes, wenn die zu-ständigen Instanzen ihm lediglich unter der Bedingung seiner Anpassungsbereit-schaft Qualität bescheinigten? Die Lehrer ihn einen guten Schüler, die Professoren einen strebsamen Studenten, die Vorge-setzten einen brauchbaren Mitarbeiter, die Seelsorger einen guten Christen nennen wollten, aber nur um den Preis seiner Nonkonformität. Er kannte natürlich das System und seine Exponenten, wußte mittlerweile, was er zu sagen oder zu tun hatte. Der weite Bereich seines Inneren, der niemanden interessierte, blieb weitge-hend unentdeckt, auch von mir, der auf seltsame Weise sein Vetrauen besaß. Im-merhin akzeptierte ich ihn doch mehr oder weniger wie er war (der Vorteil einer dia-lektischen Einstellung, wie ich ihn hänsel-te). Ich glaube, daß er – wenngleich fast noch unbewußt – nicht zufällig die schwie-rigste von vielen denkbaren Möglichkeiten gewählt hatte, radikal in seinem Streben nach Kommunikation, aber nach einer Kommunikation, die für andere ohnehin selbstverständlicher Standard war.
——
C.J. hatte seit Jahren zu sich selbst ge-schwiegen. Als Johannes ihn kennen-lernte, sagten sie einander Konventionel-les. Obwohl C.J. sich nicht als Katholik exponierte, fühlte es Johannes mit den in der Kindheit entwickelten Sensoren. Das Milieu, dem er selbst entstammte, war sehr einprägsam gewesen: eine Tendenz, die bei einigen seiner Verwandten bis zur peinlichsten Frömmelei reichte. Gerade während seiner Pubertät war Johannes unter dem Einfluß eines Geistlichen ge-standen, der ihm schwere Gewissenslasten auferlegen wollte, und wenn mein Freund dennoch aus den Niederungen des Pharisäertums dennoch emporstieg zu einem kritischen Bewußtsein, war das al-lein seinem außergewöhnlichen Verstand zu danken – und ich halte es für wesentlich hinzuzufügen, daß er ein noch stärkerer Neurotiker geworden wäre, hätte er nicht entgegen allen in der Beichte erteilten Vorhaltungen doch onaniert. Die Kirche zu verlassen, weigerte er sich damals, weil er sie noch immer als geistige Heimat, wenn auch nach seiner Façon, beanspruchte. In diesem Punkt waren wir einander sehr nah, er dort und ich in meiner Partei: gegen die Pervertierung an sich revolutionärer Ideen, deren zeitgenössi-sche Sachwalter sich mit dem Ausbau ge-nau jener hierarchischen Strukturen be-schäftigten, die in der Entstehungsphase beider Bewegungen bekämpft worden wa-ren.
Man könne in der katholischen Kirche vie-les hinnehmen, erklärte mir Johannes im-mer wieder, viele Fehler in Strategie und Taktik der Seelenrettung, viele Abschwei-fungen vom ganz einfachen zentralen Ge-danken. Was ihn aber aufbrachte, war die tatsächliche Doppelmoral: Priester wie Laien, die von Liebe sprachen und nicht liebten. Diese Auserwählten, wie er sie abschätzig nannte, hatten ihn, als er intel-lektuell noch völlig wehrlos gewesen war, rigoros bearbeitet und in ihm eines ihrer wenigen wirklichen Opfer gefunden: einen der lange Zeit tatsächlich alles, was sie sagten, für wahr hielt. Selbst als er zu zweifeln begann, verhielt er sich fair, ar-gumentierte redlich. Aber so bekam er die schlauen Kirchenleute natürlich nicht zu fassen. Kaum hatte er einen ihrer Wider-sprüche nachgewiesen, bezogen sie flexi-bel andere Standpunkte und behaupteten zuletzt sogar, niemand wolle ihn zu etwas zwingen: ganz so, als ob es irgendeinen Bewohner des Abendlandes gäbe, der sich diesen Fangarmen entziehen könnte. Das wütende kirchliche Sperrfeuer gegen di-verse Rechtsreformen veranlaßte auch mich schließlich dazu, voll hinter jenen Bestrebungen meiner Partei zu stehen, die Ehe, Geburtenkontrolle, das Gewissen schlechthin und die Religion als solche zur Privatsache machen wollten. Über jenen Priester erfuhr Johannes übrigens später, daß er kleinen Buben im Beichtzimmer gerne an den Pimmel faßte, aber das war dann auch schon nur mehr – wenn auch schmutzige – Geschichte.
—–
Meine eigene Kindheit und Jugend? Die habe ich großteils allein verbracht oder mit Gleichaltrigen, jedenfalls weitgehend ohne Drill und Organisation. Ich war nicht einmal – wie es die spätere Parteikarriere vermuten ließe – bei den Roten Falken, auch nicht bei den sozialistischen Mittelschülern: ein Spätberufener trotz klassenbewußter Herkunft. Mein Vater brachte es vom Maschinenschlosser zum Werkmeister in einem großen verstaatlich-ten Betrieb, machte die Abendmatura und war schließlich als Abteilungsleiter für den Export von Papiermaschinen in die Ost-blockstaaten zuständig. Ich sah ihn recht wenig, und wenn, dann hinter seinen Bü-chern oder später vor dem Fernsehappa-rat: irgendwann war er zur Ansicht ge-langt, dem Weiterbildungsideal seiner alt-roten Wurzeln genug gehuldigt zu haben. Wenn ich an ihn zurückdenke, erinnere ich mich sehr stark an Szenen, die ganz aus dem Zusammenhang gerissen sind, etwa an den ständig wiederkehrenden Vorgang, daß ich ihn um 50 Schilling anbettelte, um abends ausgehen zu können. Einzig bei diesen Gelegenheiten wagte es der intro-vertierte Mann, sich nach den Erfolgen meiner späten Gymnasial- und frühen Universitätszeit zu erkundigen, freilich oh-ne daß ich ihm jemals allzu befriedigende Auskünfte geben konnte. Seufzend pflegte er dann den Fünfziger herauszurücken (das war damals eine Menge Geld für einen Abend im Kaffeehaus oder in der Dis-kothek), und ich konnte erleichtert abzie-hen. Vielleicht tue ich ihm unrecht, aber ich vermute noch heute, daß sein Interes-se weniger mir selbst galt als einer Fort-setzung des sozialen Aufstiegs seiner Fa-milie in meiner Person: vom Großvater, der als Hilfsarbeiter aus einem Randgebiet der Monarchie nach Wien gekommen war, bis zum Enkel, dem Akademiker. Ich habe allerdings mein Betriebswirtschaftsstudium nach einigen Semestern abgebrochen, als ich durch meine politische Tätigkeit mehr und mehr in Anspruch genommen wurde. Die Enttäuschung meines Vaters war so umfassend, daß ich sie bis heute nicht richtig ermessen kann: Berufspolitiker wa-ren für ihn, das einfache Parteimitglied, ohnehin die personifizierten Faulpelze.
Meine Mutter war Krankenschwester. Ich erinnere mich im Zusammenhang mit ihr zuallererst an ein Gefühl von Wehmut, das sich frühzeitig in mir festfraß: bei meinen Schulkollegen war an die Mutter, selbst wenn sie einem Beruf nachging, die abendliche Geborgenheit daheim ge-knüpft, meine Mutter aber – so übertrieb mein kindliches Gemüt – verbrachte ihre Nächte im Krankenhaus. Das Wort Nacht-dienst prägte sich mir ein, später in Ver-bindung mit Geschichten darüber, was Ärzte und Schwestern miteinander trieben. Als es mit mir so weit war, ordnete ich meine Mutter unter die schönsten Frauen meines erotischen Wertmaßstabes ein. Ich genoß die seltenen Gelegenheiten, mit ihr spazieren zu gehen, weil sie wirklich blendend aussah, und ich war hochgestimmt, wenn sie in der Straßenbahn vor allen Leuten in einer Aufwallung von Gefühl ihren Arm um mich legte. Ich begann durchaus den – fiktiven oder tatsächlich vorhandenen – Dozenten oder Professor zu verstehen, der sich an sie herangemacht und sie fest, fast ein wenig brutal an sich gezogen haben mochte, in der Absicht, dieses schöne Stück Weib zu besitzen.
Wenn ich als junger Mann manchmal mit meiner Mutter ins Schwimmbad ging (der Vater, der um einiges älter war als sie, blieb meist zuhause, um für seine niemals endenden Prüfungen zu lernen oder später um einen komplizierten Geschäftsfall noch einmal in Ruhe durchzukalkulieren), schwelgte ich in den wohlgeformten ana-tomischen Einzelheiten ihres Körpers und nahm mir fest vor, auch einmal eine solche Sexbombe zur Frau zu nehmen. Sie war naturblond, und ihre Haut blieb selbst in der Sonnenbestrahlung langer heißer Sommer nahezu weiß. Sie pflegte für da-mals ganz unüblich knapp geschnittene Bikinis zu tragen, was zur Folge hatte, daß nicht allein meine Blicke auf ihrem üppigen Körper ruhten. Ich empfand dabei keinerlei Eifersucht, sondern Stolz, fühlte mich eingehüllt in ihre körperwarme Liebe, die sie mir – wann immer sie da war – reichlich fürs Leben mitgab.
—–
Nachdem ich den elterlichen Haushalt ver-lassen hatte, wohnte ich in einem der neuen Gemeindebauten an der Alten Donau, kaum fünf Minuten von Sonja Ma-ria entfernt. Ich dachte noch immer dar-über nach, wie ich Johannes helfen konn-te. Eines Tages besuchte ich Sonja Maria, diesmal allerdings nicht in parteioffizieller Mission. Als ich eintrat, fielen mir gewisse Reisevorbereitungen auf, die ich aber nicht beachtete. Ich lud die erstaunte Sonja Maria zu mir nach Hause ein, obwohl ich nicht genau wußte, worauf das hinaus-laufen sollte. Ich war nur sicher, daß Jo-hannes sich bereits – wie in letzter Zeit abends immer – bei mir eingefunden hatte. Eine Aussprache zwischen den beiden hielt ich an sich für überflüssig, da es in Wirklichkeit keine offenen Fragen gab. Was mich viel mehr interessierte, war, ob überhaupt noch eine Gefühlsbasis existier-te, auf die man sinnvoll aufbauen konnte.
Johannes saß tatsächlich in meinem Wohnzimmer. Sein Äußeres war glückli-cherweise einigermaßen zivilisiert, nur sein etwas glasiger Blick verriet Alkoholeinfluß. Als er Sonja Maria erkannte, erhob er sich langsam, wobei er sich mit beiden Händen auf den Tisch stützen mußte. Ich rechnete mit allem Möglichen, nur nicht mit dem, was tatsächlich geschah: Sonja Maria ging nach ganz kurzem Zögern mit einigen schnellen Schritten auf ihn zu, umarmte und küßte ihn. Erst nach einer für mich als Beobachter unendlich langen Weile rea-gierte Johannes, indem er ebenfalls seine Arme um sie legte und ihren Kuß erwider-te.
Ich verließ das Zimmer, die Wohnung, das Haus, wanderte durch die umliegenden Straßen, immer wieder unter meinen Fenstern vorbei. Als die letzten Menschen von den Straßen verschwanden, hatte mein Spaziergang schon stundenlang ge-dauert: mir war jetzt klar, daß bestimmte Lebenshaltungen zu einer Einsamkeit füh-ren, die etwas völlig anderes ist als das nicht ganz unangenehme Alleinsein. Ich dachte an meine Mutter, und ihre Wärme erfüllte mich selbst in dieser Situation und hielt mich ganz fest am Leben. Irgendwie scheute ich mich davor, ein Kaffeehaus anzusteuern. Ich hätte gern jemanden angerufen, wußte aber nicht wen. Es gab niemanden, der die konkrete Situation dieser Nacht verstehen oder auch nur ein-fach mich begreifen konnte: ausgebrannt, nur am Funken eines Kindheitstraumes sich erwärmend. Sonja Maria und Johan-nes, bis dahin in meinem Bewußtsein ge-trennt geführt, waren zur Einheit gewor-den und hatten sich als solche weit von mir entfernt. Ich konnte nicht mehr ver-stehen, was jeder von ihnen mir einzeln bedeutet hatte. Ich fühlte keinen Schmerz, lediglich das Unbehagen der Sinnlosigkeit. Was sich vor mir ereignet hatte und was sich mutmaßlich weiter ereignete, entzog sich jeder vernünftigen Erklärung, obwohl ich selbst es herbeigeführt hatte. Mir fehlte da eine Dimension: das Nachvollziehen einer fundamentalen Veränderung.
Als ich Sonja Maria und Johannes gegen drei Uhr morgens engumschlungen aus meinem Haus kommen sah, wunderte ich mich nicht. Ich folgte ihnen von weitem: mein Freund brachte seine Angebetete heim. Nach langen Küssen verabschiedete er sich vor ihrer Tür und ging dann selbst nach Hause. Diesmal hatte es jedenfalls geklappt und sie hatten miteinander ge-schlafen. Mit dieser Erkenntnis ging ich dann endlich auch zu Bett. Beim Einschla-fen dachte ich an Jugenderlebnisse, durch die eine zunächst ungreifbare Sehnsucht gegenständlich gemacht und verstärkt wurde. Mit meiner Cousine, die einige Jah-re hindurch die Ferien in meinem Eltern-haus verbrachte, war erstmals ein gleich-altriges weibliches Wesen zum Anfassen in meine Welt getreten. Unaufgefordert griff ich allerdings nicht zu, nur wenn das Mäd-chen mich bat, den Reißverschluß ihres Kleides zu schließen, oder wenn sie mir im Überschwang sommerlicher Freiheit um den Hals fiel.
Am nächsten Morgen kamen Johannes und ich auf unserem Weg zur Straßenbahn – er mußte an die Universität, ich in die Parteizentrale – an Sonja Marias Haus vorbei. Sie war gerade dabei, ihr Gepäck im Auto des Regierungrates zu verstauen, was auf den Beginn einer Geschäftsreise hindeutete. Sie sah an diesem Tag beson-ders schön aus, lediglich ihr Lächeln, als sie Johannes bemerkte, war etwas ge-quält. Sicher wollte mein Freund etwas fragen, aber ich drängte ihn weiter. Als er in die nächste Seitengasse bog, wollte ich ihm vieles sagen, aber ich folgte ihm nicht.
—–
AUS DEM LITERARISCHEN WERK DER AMÉLIE N. ALIAS „AGENT DREAM“
Dokumente einer möglichen Existenz
Hrsg. von Claudia Th. unter sorgfältiger Bearbeitung
August 1968
I.
Lettern in der Zeitung balkendick:
Es ist geschehen.
Registriert nicht, schreibt
wir werden handeln
in Buchstaben riesengroß.
Mörder unter uns, die Sonne scheint.
Wiesen grünen und Gewalt rückt vor.
Liebt einander, denn es kommt der Schwarm
der Pfeile, der tödlichen Pfeile.
Steht schnell auf, geht
vor die Tür.
II.
Es hat keinen Sinn,
meinen Namen zu nennen.
Ich habe ihn verloren, Schande überkam mich.
Ich denke immer lange und so wird es stets
zu spät:
Lebe mit beschränkter Haftung, esse,
schlafe unverdient,
werde fortgeschwemmt vom Regen
ohne Widerstand.
Kies, nein Sand: doch
plötzlich bin ich ganz gesammelt.
III.
Sie verkleben dir die Ohren, Augen.
Stört dich nicht.
Sie berauben dich, das
schmerzt dich, denn
nun kannst du dir kein Bier mehr kaufen.
Und man stellt dich an die Wand:
ein Irrtum?
IV.
Bist du schuldig?
Hältst du dich für voll vertrauenswürdig?
An dich, an dich nur, denn
das Licht der Drähte hat mich hell erleuchtet.
V.
Gina: Haut wie Morgentau.
Gina: ein Gin-Tonic mit Esprit.
Gina: Minikleiderfrau.
Gina: you are thrilling me.
Gina: Seidenrosenduft.
Gina: Vorhangsonnenschein.
Gina: weiße Arbeitskluft.
Gina: liebe mich, sei mein.
VI.
Eine Nacht ist rasch zu Ende.
Alles Leben, bis
der Morgen wiederkommt,
mit dem dumpfen Ton, als sie
mich holten, unbekannten
Orts verschleppten,
ging ich wie auf Wolken, denn
sie liebte mich.
Was mit ihr geschah?
Ist sie auch Opfer oder hat sie sich
verkauft, dem der am meisten bot?
VII.
Macht Programme, revoltiert!
Rächt die Frauen, rächt die Männer!
Rächt die Zwänge und den Tod!
Rächt den Sommer noch im Jänner!
Hindert, daß noch mehr passiert!
VIII.
Wo ist dein Bruder? –
weiß es nicht! –
Wo bist du, Bruder? –
Wo bist du nur hingegangen? –
Aus „Revolution“
—–
Diesmal nimmt der Verleger die Brille ganz ab und blickt ins Leere. Einer Bemerkung zuvorkommend, sagt er: Ich weiß, das Gedicht ist nicht von Ihnen. Und ohne weiter darauf Bezug zu nehmen: Themelis ist also der Ansicht, daß es gefährlich sei, sich mit der Partei, gleich welcher, anzule-gen?
Gefährlich ist es allemal, vor allem für Mitglieder, deren bedingungslosen Gehorsam man geradezu voraussetzt. Sonst kommt es nämlich schon einmal vor, daß man Personen ausschaltet.
Ausschaltet?
Vernichtet – ihre materielle Existenz oder ihre Familie oder ihre berufliche Zukunft oder alles zusammen.
Aber das ist doch unfaßbar!
Sie sagen es, Herr Direktor. Ich hoffe aber, Sie sind nicht wirklich erstaunt, denn sonst müßte ich annehmen, Sie lebten auf dem Mond.
Aber dann verniedlichen Sie die 60er Jahre in Ihrem Text, Themelis!
Der Text zeichnet die Zeit nach: einen zynisch regierten Vormärz. Private Schicksale sublimierten die gesellschaftspolitische Katastrophe, die nicht geboren, sondern von den Mächtigen abgetrieben wurde.
Ihr Österreicher seid wirklich das sprichwörtlich gewordene ulkige Völk-chen!
Was soll’s, die wenigen Widerstandskämpfer gegen die Nazityrannei haben in der Illusion gehandelt, eine Demokratie zu erschaffen. Aber in Wahrheit haben sie ihren Kopf für die Restauration des Korporativismus (in Österreich auch Ständestaat genannt) hingehalten. Wir sind nach 1945 das Land der eifrigen Konvertiten geworden: cuius regio eius religio – nur hat das kaum jemand bemerkt. Bruno Marek zum Beispiel, der leutselige Wiener Bürgermeister (Ex-NSDAP-Mitglied übrigens) wurde vom schillernden Wiener Journalisten Günther Nenning (Ex-Nazi-Opfer übrigens) mit der Wahrheit verhöhnt, indem er nämlich Originalzitate des Politikers zu einem neuen Parteiprogramm montierte:

Insgeheim, Themelis, wenn ich Sie so höre, kann ich jene verstehen, die sagen, wir hätten damals 68 den blutigen Umsturz wagen sollten, die endgültige Zerstörung der Allianz von Thron und Altar. Dann – sagen die – müßten wir uns nicht heute schon wieder mit diesem Mief herumschlagen, dem es immer von neuem gelingt, auch hochzivilisierte Völker zu bestialisieren.
Ich bin ganz Ihrer Meinung, Genosse Direktor. Aber es wurde noch schlimmer. Auf jedes ehrliche Nachdenken erntete man nur Kusch-Reflexe, entweder gleich ohne jedes Argument oder mit der konzilianten Vertröstung „Ja, aber nicht gerade jetzt!“ – so als ob die Zeit jemals günstig für Reformen gewesen wäre (schließlich stand man ständig vor irgendwelchen Wahlen). Was hat angesichts dieser Frustration Millionen davon zurückgehalten, Revolution zu machen?
Eine einfache Erklärung, deshalb nicht weniger einleuchtend. Wenn ich auf meinen Geschäftsreisen das eine oder andere Mal ein Wochenende hier in Wien festsitze, gehe ich am Sonntagvormittag von meinem Hotel hinein in die City, setze mich in den Stephansdom und höre Palestrina, zum Beispiel die Missa Aeterna Christi Munera, und ich genieße es, obwohl ich weiß, daß das wunderschöne Gebäude einen zweiten mystischen Leib hat, der aus der Fron derer besteht, die es errichtet haben, und obwohl ich weiß, daß der Komponist, als er beim Kardinal d’Este im Dienst war, von diesem als ein notenschreibender Knecht betrachtet wurde, der auf ein Fingerschnippen seines Herrn Melodien auskotzte. All das wissend, sitze ich dort drinnen und bin ergriffen.
Und Gott nahe?
Auch das, Themelis, denn Gott kann unter Umständen auch ein angenehmes Gefühl sein, eine Hängematte des ermüdeten Geistes in der Abendsonne des Denkens.
—–
Es gibt Tage, an denen ich an die Revolution denke. Plötzlich, während ich als sozia-listischer Funktionär im eleganten, dezent gestreiften Anzug mit Parteifreunden beim Mittagessen sitze, träume ich davon, mit denen zu marschieren, die ihre Schirmkappen über blassen Gesichtern tragen. Ich denke an die Qualen, die das russische Volk vor allen anderen ertragen hat, bis es aufstand. Ich denke aber auch an die neuen Herren, die es sich einhandelte: und da möchte ich denen mit den erhobenen Fäusten und den schwermütigen Liedern zu einem späten Sieg verhelfen. Ich, der nie gelitten hat wie sie, habe beim Anblick des Kreuzers Aurora, der als Museumsstück an der Mole von Leningrad liegt, geweint. Die Aurora hat das Feuer eingestellt. Die Revolution ist tot.
Irgendwo, irgendwann fiel sie uns endgültig zum Opfer, weil wir keine Achtung vor den Menschen haben. Wir ermorden sie mit unseren Phrasen, die leicht über die Lippen kommen und schwer zu Boden sinken: sinnlos und mit Bosheit beladen. Prost und Mahlzeit, Genossen, Parteifreunde hier an meinem Tisch (ich denke es nur, noch denke ich es nur): wie Fußballfunktionäre den Sport nur vom Zusehen kennen, ist politischen Funktionären die Arbeit der Menschen, die sie vertreten, nur vom Hörensagen bekannt. Arbeit ist für uns Mandatare etwas Exotisches, an das man während Arbeitsessen, Ar-beitstagungen und Basisarbeit nostalgisch zurückdenkt. Weit in der Vergangenheit liegt der Tag, an dem uns der Schweiß der Arbeit über die Stirn floß. Vielleicht vergeude ich auch mit dieser Niederschrift nur meine Zeit.
In Momenten wie diesem fiel es mir besonders schwer, mich auf das Tagesprogramm zu konzentrieren, zumal meine Gedanken so intensiv um Johannes kreisten, der mir nicht nur im Zusammenhang mit Sonja Maria einiges aufzulösen gab. In einem Kreis literarisch Interessierter, in den er mich manchmal mitnahm, las einer aus einem Romankonzept über Jesus von Nazareth vor und fragte ausgerechnet mich um meine Meinung zu einem Text, der bis dahin nur aus einigen wenigen Seiten bestand und keinerlei ausgeprägte Tendenz erkennen ließ. Nun war ich durch langjährige Übung durchaus in der Lage, zu einem beliebigen Stichwort etwas aus dem Stegreif zu sagen, doch wirkte das gegen Ende der 60er Jahre eher bei Realpolitikern als bei Intellektuellen. Ich sprach über mein eigenartiges persönliches Verhältnis zu Gott, der mir, wie es so kommt, in der Kindheit auf eine für später wenig brauchbare Weise nahegebracht worden war. Ich bin Taufscheinkatholik, und doch ein wenig mehr als das. Der einmal gegebene Impuls hatte immerhin Wirkung gezeigt, wenn auch mangels weiterer Anstöße mein Gottesbegriff nie definiert wurde. Beim damals erstmals unternommenen Formu-lierungsversuch scheiterte ich nicht zuletzt daran, daß mir das einschlägige Vokabular fehlte.
Insgesamt empfand ich das Religiöse als zu jenseitig und den Hinweis auf bessere Zu-stände nach dem Tod als zu weltflüchtig. Überdies gerieten mir auf diesem Gebiet Ver-stand und Gefühl in Konflikt wie nirgendwo sonst. Was beim Anhören von Musik in mir aufstieg, mochte schon manchmal in eine religiöse Richtung gewiesen haben, aber in der Literatur verlangte ich Realismus. In dem erwähnten Kreis machte man mir daher den Vorwurf, Bewußtseinsvorgänge, die zweifellos subjektiv vorhanden waren, zu ne-gieren: was ich nicht zurückweisen konnte. Und ich fand langsam Gefallen an dem Je-sus-Roman, von dem ich weitere Bruchstücke lesen durfte. Der Autor versuchte unter anderem, die Verbindung zwischen dem endzeitlichen Charakter Roms und der Jetztzeit herzustellen, wobei nicht alle Anwesenden diese Ähnlichkeit bejahten, ich aber Belege aus der ökonomischen Perspektive beisteuerte.
Johannes – abseits aller Ökonomie – dozierte lebhaft über die Erwartung eines neuen Reiches, etwa anhand der Ideen des Gioacchino di Fiore, jenes Schriftstellers aus dem dreizehnten Jahrhundert, der die bisherige Geschichte in ein Reich des Vaters und ein Reich des Vaters und ein Reich des Sohnes teilt und als noch ausständig das Reich des Heiligen Geistes nennt, das kein Staat mehr sein soll, sondern eine brüderliche Gemein-schaft: also eine bedeutsame Konkretisierung der christlichen Heilslehre (auch bei Leni-nisten klingelt es, wenn sie das hören). Wie auch immer, von der Amtskirche längst über Bord geworfen, von den Gläubigen mit Desinteresse bedacht, ist auch im Christen-tum die Revolution tot.
—–
Was ist eigentlich für Sie links, Themelis? Ist mehr geblieben als eine bloße Attitüde des intellektuellen Publikums?
Da kann Ihnen ein kurzer Artikel von Michael Maier dienen, Herr Direktor. Der sagt eigentlich alles.
Der Michael Maier, der über die Grenzen Österreichs bekannt wurde, als er die gute alte Wiener „Presse“ veräppelte?
Das war, nachdem er als Chefredakteur geschaßt worden war. Davor – noch in diesem Amt – schien er mir der einzige in der konservativen Zei-tungslandschaft, der klare Worte zu Kardinal Groër gefunden hat, solcherart bekundend, daß man als Bürgerlicher nicht zwangsläufig über klerikale Päderastie hinwegsehen muß.
Und wie definiert Maier die linke Seite des Spektrums?
Beschäftigung mit der ewigen sozialen Frage, dem eigentlichen Kernthema des Sozialismus: als Antwort schon mitverpackt, daß Höhenflüge auf dem Aktienmarkt, zumal wenn sie mittels Entlassungswellen erzielt werden, nicht der Sinn des Lebens sein können. Neuauslegung der alten sozialdemokratischen Tugenden auf Basis eines richtig gesunden und handfesten Grundsatzstreits: denn es kann ja nicht der Weisheit letzter Schluß sein, daß junge Parteifunktionäre schon alt, alte Herz- und Hirnideologen aber noch immer jung sind. Beiden sind schließlich die Massen davongelaufen und haben sich der großen rechtspopulistischen Bewegung angeschlossen – dennoch sollte es eine Zeit danach geben, in der das Volk von den Lin-ken, und von niemandem sonst, eine neue Sinngebung fordern wird.
Und Sie glauben, diese Tradition könnte, sozusagen in Zellen abgekapselt und immunisiert, jeglichen Terror überleben?
Die Revolution, Herr Direktor, von der wir heute schon so oft gesprochen haben, stößt in säkularen Bewegungen vor, zieht sich allerdings auch wieder zurück. Jede Revolution hat ihre Schreckensherrschaft, ihren Thermidor, ihren Bonapartismus – und zuletzt eben die mehr oder weniger intensive Restauration und damit wieder Ansätze für neuerliche Kritik. Niemand errichtet brennende Barrikaden für höhere Löhne, sondern – unserem Kulturpessimismus zum Trotz – für eine fast esoterisch zu nennende geistige Befindlichkeit.
Das wissen Sie alles ganz genau, Themelis?
So genau wie wir zugeben müssen, daß das Sein unser Bewußtsein formt, daß wir aber nicht Menschen wären, wenn nicht auch ein deformiertes Bewußtsein eine alternative Fiktion von sich selbst entwerfen könnte – und damit die Konzeption eines alternativen Seins. Unsere spezifisch menschliche Tragik liegt nämlich hinsichtlich dieses Theorems leider schlicht in der Erkenntnis, daß wir mit den uns gegebenen Entscheidungsinstrumenten in der Regel zu eklatanten Fehlurteilen gelangen. Das haben übrigens ganz banale psychologische Versuchsreihen ergeben, in die man gar nichts hineingeheimnissen kann.
Dann besteht aber genau darin das Drama der gesamten Menschheitsgeschichte!
Nicht der ganzen Geschichte, jedenfalls nicht dort, wo naturnahe (oder wenn Sie wollen: tiernahe) hominide Lebensformen auf riesigen Räumen mit extrem dünner Bevölkerungsdichte existiert haben: dort war alles eher statistisch zu sehen (indem bei binären Entscheidungssituationen eben einer von zweien durchgekommen ist). Später hätte man dann genausogut würfeln können statt auf die Entscheidungskraft eines wie immer gearteten Souveräns zu vertrauen.
So habt Ihr Österreicher Euren politischen Absolutismus also in der historischen Lotterie gewonnen, Themelis?
So könnte man es ausdrücken…
Immerhin hat man bei Ihnen (wie auch anderswo in Europa) die Herrschaft des starken Mannes einigermaßen gut vorbereitet, indem man den alltäglichen Gewaltpegel stark ansteigen ließ. Selbst die höchstentwickelten demokratischen Gesellschaften sind nicht robust genug, um damit fertig zu werden.
Sie spielen natürlich auf den jämmerlichen Umgang Westeuropas mit dem anscheinend anachronistischen Ausbrüchen des Nationalismus auf dem Balkan an…
… zum Beispiel, ja: über 100.000 Tote, Millionen Flüchtlinge direkt vor unserer Haustüre, aber mehr noch – hinter diesen Zahlen die Art der Gewalt, nämlich Mord, Verstümmelung, Vergewaltigung, Entwurzelung als systematisch eingesetzte Kriegsinstrumente. Dann die kriminelle Form der Gewalt im eigenen Land mit der Triebfeder des Wohlstandsgewinns selbst dann, wenn dieser auf die übliche Weise nicht erzielt werden kann. Und schließlich die Gewalt an den Schulen und innerhalb der eigenen vier Wände als Ausdruck pädagogischer, familiärer oder sozialer Katastrophen. Über all dem, nicht zu vergessen, die drehorgelgleiche Gewaltsymphonie der Medien, nicht zuletzt des Fernsehens bis hin zur äußersten Sublimation in Form amoralischer Supermenschen.
Ich kann das alles schon gar nicht mehr hören, so oft ist das schon be-jammert worden, Herr Direktor!
Aber lieber Freund, der starke Mann ist schlußendlich gekommen – gerufen von allen Fasern der gewaltbereiten Gesellschaft. Jetzt müssen Sie sich noch mehr anhören, ohne jammern zu können.
Zum Glück gibt es noch ausländische Verlage, die sich mit subversiven Texten auseinandersetzen.
—–
Wenn ich abends allein zu Hause saß, stand manchmal eine fremde und doch bekannte Person im Zimmer und verwandelte die vertraute Banalität des Raumes. In meinem Gehirn begannen chimärische Stimmen, eine dunkle, völlig unverständliche Sprache zu sprechen. Auf diese Weise begegnete ich öfters dem Tod, und diese Erfahrung wäre nachzutragen, wollte man eine Bestandsaufnahme des Religiösen unternehmen. Den Tod zu benennen heißt, ihm das Drohende zu nehmen: dem dauernden Tod, der – wer sonst – Gott ist in unserem endlichen Dasein, und dem kleinen Tod der Bewußtlosigkeit. Das Glück des einzelnen, das als solches gar nicht angelegt ist in der Geschichte unserer Art, sah ich seit meiner Kindheit gemäß den sternschnuppenhaften Liebesbezeigungen meiner Mutter als Geschenk des Augenblicks. Ich empfing und später, als ich zu geben gelernt hatte, tat ich auch das. In dem Maß mir bewußt wurde, daß ich kein Recht auf Glück hatte, hörte ich auf, es anzustreben und konzentrierte mich darauf, bereit zu sein für den Fall der Gewährung.
Ein Duzfreund aus dem Lager des politischen Gegners – wir kannten einander so gut, daß es geradezu obszön war, wenn wir einander in öffentlichen Diskussionen bekämpf-ten – stellte mir eines Tages am Graben seine Schwester vor: eine exotisch wirkende Schönheit mit strahlenden Augen. Nach allem, was von mir bisher bekannt ist, erstaunt es nicht, wenn in mir sofort eine Lawine an Zuneigung losbrach. Das Bedürfnis, sie zu besitzen, verstärkte der Bruder dieses Geschöpfes – dabei hatte ich kein Wort gesagt, natürlich nicht, was denn auch – mit der sarkastischen Bemerkung, daß ich mir an ihr die Zähne ausbeißen würde. Vielleicht meinte er das bloß weltanschaulich, denn die ersten zwei, drei Male, die ich sie traf, verbrachten wir mit politischen Meinungsver-schiedenheiten. Der Machtwechsel schien zum Greifen nah: regionale Wahlergebnisse im Ausland ließen einen Trend zur Sozialdemokratie erkennen, und die Konservativen wurden langsam nervös. Im Kaffeehaus mit Claudia (so hieß die Wunderbare) bewegten wir mit unseren Argumenten die fiktiven Wählerpotentiale. Unversehens fand ich mich in der Lage, die von mir parteiintern kritisierten Genossen zu verteidigen, die auch in Österreich die pragmatische Wende vollziehen wollten.
Das war freilich etwas anderes als die lethargische Reaktion Sonja Marias. Bei Claudia stoben die Funken, und sie war nicht gerade wählerisch in ihren argumentativen Me-thoden und mit ihren Begriffen. Bei der Frage, was ich, ein intelligenter, gutaussehender Mann bei den Roten verloren hätte, wurde mir klar, worauf ich mich da eingelassen hatte. Aber gerade da faßte ich auch den Entschluß zum Ganzodergarnicht: Intelligenz, bemerkte ich, sei einem nicht gerade zum Zweck des reinen Imponierens gegeben, aber was das andere betreffe, sei ich durchaus bereit zu individuellen Reaktionen. Ich ergriff ihre Hand, und als ich den mir wohlbekannten Druck der Zustimmung wahrnahm, zog ich Claudia entschlossen an mich und küßte gierig diesen Mund, nicht achtend der Zitate aus der bürgerlichen Presse, die kurz davor aus ihm hervorgegangen waren. Claudias Duft aus nächster Nähe schaltete ganz schnell diverse Verstandesmechanismen in mir ab. Meine Nervenenden schienen zu vibrieren, als ich mich widerstandlos in die Situation hineinfallen ließ.
Daß wir zusammen einen Ball besuchen würden, war von diesem Tag an beschlossene Sache. Bis dahin genoß ich es, die Dinge sich langsam entwickeln zu lassen. Die Vor-freude darauf, mit Claudia zu schlafen, erfüllte die alltäglichen Verrichtungen ebenso wie unser abendliches Ausgehen mit unwirklichem Glanz. Früher erworbene Narben der Seele gewannen nachträglich ihren Sinn. Die Musik, die wir gemeinsam hörten und die sich ideologischen Debatten weitgehend entzog, stieß neue Dimensionen auf.
Den Ball im Hotel Intercontinental besuchten wir zu viert. Johannes hatte Sonja Maria nach ihrer Rückkehr von der Geschäftsreise wiedergetroffen. Hin- und hergerissen zwi-schen der bereits vollzogenen Abkehr und dem Traum von einer Renaissance, kapitu-lierte er vor Sonja Marias plötzlicher Neigung, sich weiter mit ihm zu beschäftigen. Es ist Johannes‘ zynische Interpretation, die ich damit wiedergebe, und sie zeigt, daß er zu simpel dachte, wenn er auf ihre Unlust zur Entscheidung starrte. Was er in Wirklichkeit wollte, war ihr die Entscheidung zu überlassen, anstatt selbst die Initiative zu ergreifen. Das Tischgespräch auf dem Ball wollte nicht recht in Gang kommen: einerseits war, was ich meinem Freund zu sagen hatte, in dieser Umgebung unsagbar, andererseits kamen unsere Damen nicht miteinander klar. Johannes und ich hatten auf geistvolles Blödeln geschaltet, worüber meine Begleiterin in Unmut verfiel, denn dazu war sie zweifellos nicht mit mir ausgegangen. Ein neues Kapitel im ewig gleichen Spiel: die Schwäche des einen ist die Stärke des anderen und umgekehrt.
Sonja Maria und Johannes blieben aber nicht lange am Tisch. Sie wechselten an die Bar, trieben sich im Foyer und in den Wandelgängen herum. Sie tanzten viel, offen und wild, was damals gerade in Mode war. Auch Claudia und ich tanzten: Claudia lag versöhnt und besitzergreifend in meinen Armen. Sie preßte sich ganz an mich, begleitete exakt jeden meiner Schritte in völliger Einfühlung. Ich begehrte sie. Es war klar, was wir nach dem Ball miteinander tun würden. Wir sprachen davon ab und zu, und jedesmal kam Claudias Gesicht mir mit leicht geöffneten Lippen ganz nahe. Wenn ich sie küßte, wur-den ihre Augen ganz seicht, wie um mir zu zeigen, daß es in ihnen und in Claudias Gedanken in diesem Augenblick nichts gab als mich. Ich begnügte mich fortan mit we-nigen Sätzen, ließ Claudia die Zärtlichkeit fühlen, die ich für sie empfand.
Ich nahm gehörigen Abstand von Johannes‘ Problemen, zumal er mir in dieser Ballnacht hinlänglich glücklich erschien. Manchmal fragte ich mich, was er mit Sonja Maria be-sprach. Möglicherweise quälte er sie nicht mit sinnentleerten Begriffen, wie ich es getan hatte, sondern forderte seine Geliebte auf, sich mit sich selbst zu beschäftigen, das Le-ben nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten (das ist meist der Punkt, an dem man bereit ist, abzuspringen). Nicht nach einem bestimmten Schema sollte sie reagieren, sondern neue innere und äußere Impulse ebenfalls gelten lassen und verarbeiten. Ich hörte Johannes förmlich, wie er ihre Aufmerksamkeit auf den Fortgang der Ereignisse richten wollte, aber warum vermied er die klare Forderung? Mit Metaphern kann man nicht dagegen ankämpfen, daß jemand wie Sonja Maria dauernd zwischen den Extre-men vollständiger Zu- oder Abneigung pendelte, und zwar ebenso in bezug auf ihn wie in bezug auf ihren anderen Freund, so als ob zwei Zwillingsschwestern abwechselnd unter ihrem Namen aufträten. Johannes kannte seinen Rivalen ebensowenig wie jene andere Sonja Maria, und mir schien es gerade in seinem Fall so müßig, eine Zauberfor-mel zu suchen, die das allgemeine Auf und Ab in einer für ihn günstigen Lage stabili-sierte.
In dieser Nacht war alles gut. Am Morgen veranstalteten wir in meiner Wohnung ein Sektfrühstück, das uns allen den nötigen An- und Abstand gab. Claudia und ich zogen uns daraufhin ins Schlafzimmer zurück, während Sonja Maria und Johannes im Wohn-zimmer blieben. Als ich viel später Zigaretten suchte und an der Wohnzimmertür „Alles in Ordnung da drinnen?“ rief, erhielt ich keine Antwort. Ich kehrte ins Bett zurück und rauchte gemeinsam mit Claudia. Dann begann sie wieder, ihre zärtlichen Hände spre-chen zu lassen, und ich vergaß meine Untermieter. Vielleicht waren sie auch längst ge-gangen.
—–
Gerade zu dieser Zeit warf eine außergewöhnliche Macht C.J., der sich von da an J.C. nannte, zu Boden und demütigte ihn tief. Ein dumpfer Schrei ertönte aus dem Mund des Gestürzten, und die ihn umringten, nahmen zwar den Laut auf, konnten ihn aber nicht deuten. J.C. versuchte, in ihrer Sprache zu reden, doch es gelang ihm offenbar nicht. Auch die Aussage seines Blickes blieb ihnen verborgen. Sie sahen ihn leiden, waren aber nicht imstande, ihm zu helfen. Als einer der Anwesenden sich aufraffte und ihn fragte, ob er Schmerzen hätte, kamen plötzlich die Worte wieder, und er sagte: Nein, ich bin jenseits davon.
Was damals geschah, weiß ich nur aus zweiter Hand, aber ich muß mich auf diese Quellen stützen, wenn ich nicht auf Dinge verzichten will, die zu dieser Geschichte ge-hören. Als J.C. die Sprache wiedergefunden hatte, konnte er auch die Personen um ihn herum identifizieren, durchwegs honorige Leute, die sehr betroffen waren über das, was er ihnen von der Nähe des Endes und der bevorstehenden Erlösung sagte. Seine Vorwürfe (denn als solches wurden die Worte aus ihm herausgeschleudert) richteten sich gegen klaglos eingespielte Organisationen, den Selbstzweck von Hierarchien, die Mechanik der Menschlichkeit. Gott ist aber nicht wählerisch, brüllte J.C., und wenn sein Ruf ergeht, dann bedient er sich eines jeden beliebigen Werkzeugs.
Etwas ruhiger geworden, sprach J.C. zu ihnen vom Ende der Hartherzigkeit, von der Errettung aus dem reißenden Strom des Leidens. Eine neue Erde kündigte er an, in der nicht länger Wunden geschlagen werden. Was zuvor an schrecklichen Dingen geschehen wird, muß um der Erkenntnis willen sein: damit keiner mehr in seiner Blindheit fragt, wozu die Erlösung notwendig ist. Wahrheit und Liebe sind eins: wer die Wahrheit kennt, muß lieben, und wer liebt, weiß alles. Ich bin unter euch, sagte er, um das Eis der Hölle hinwegzunehmen. Wenn mein Tag gekommen sein wird, werde ich eure ver-borgenen Fähigkeiten zugänglich machen, und dann werden wir alles bemerken, und nichts – kein Gedanke, kein Wort und keine Handlung – wird verloren sein.
Als J.C. das von sich gegeben hatte, blieb er noch lange Zeit stumm liegen, bis er sich endlich gesammelt hatte und den Ort des Geschehens verließ. Als er fort war, wurde wild durcheinandergeredet. Einige bezeichneten ihn als Narren, den man sofort aus dem Verkehr ziehen müßte, andere meinten, daß man es sich so einfach nicht machen könne: die alte Diskrepanz zwischen der Utopie und dem wirklichen Leben. Johannes, der bei diesem Ereignis ebensowenig anwesend war wie ich, hätte in dieser Debatte noch gefehlt mit seiner Meinung, daß die Schöpfung keinem Paukenschlag-Ende zu-steuert, sondern sich unendlich langsam fortentwickelt und irgendwann ganz unmerklich – je nach Verhalten der Menschen – in den Zustand der Erlösung oder Vernichtung eintreten wird.
Manche der Augenzeugen sahen die Ironie der Tatsache, daß Christen schockiert sind über einen, der von Erlösung spricht. Und doch war es verständlich, insofern der Messi-as selbst seine Anhänger vor falschen Propheten gewarnt hat: mit dem Rat, sie an ihren Früchten zu erkennen. Gelassenheit, sagte ich zu dem, der mir das alles erzählt hatte. Unsere Wirklichkeit ist schließlich so (und so ist unser Bild von Gott), daß wir etwas erwarten und gleichzeitig hoffen, daß es nicht eintritt; daß wir unzufrieden sind, aber vor Entscheidung und Verantwortung zurückschrecken. Es ist normalerweise leicht, Marxist oder Christ zu sein. Es ist leicht, von der Revolution zu schwärmen. Aber genau das tut er ja, sagte mein Gesprächspartner. Und mehr nicht, antwortete ich, seien Sie beruhigt.
—–
Seit dem Anruf, in dem ihm J.C. alles mitgeteilt hatte, zweifelte Johannes nicht mehr an jener Möglichkeit und auch nicht daran, daß die Situation auf die Spitze zutrieb. Damit meinte er zwar eher sein persönliches Schicksal als das Weltganze, aber wie immer wollte er diese spezifische Interpretation nicht vermitteln. Ihn zum Jünger zu erwählen, schien J.C. leicht, denn bei wem wäre die Sehnsucht nach einem endgültigen und gleichbleibenden Glückszustand – darauf lief alles hinaus, so langweilig dieser Zustand den meisten auch scheinen mochte – auf fruchtbareren Boden gefallen als bei meinem Freund. Dieser wäre J.C. noch weit kritikloser in die Arme gelaufen, hätte er seine Lage in voller Tragweite gekannt.
Der Regierungsrat, sein Konkurrent bei Sonja Maria, und ich hatten politisch miteinan-der zu tun. Außer bei den Routinetreffen der Bezirksparteiorganisation sahen wir einan-der im Unterausschuß für Verstaatlichte Unternehmen der Parteikommission für Wirt-schaftsfragen, er als Amtsträger in diesem Bereich, ich als Vertreter einer informellen ideologischen Einsatztruppe, die namens der Zentrale den Praktikern auf die Finger zu sehen hatte. Nach den Sitzungen der Bezirkspartei – die sehr prominente Mitglieder aufwies, darunter spätere Minister – fuhren wir meistens zu einem Stammersdorfer Weinhauer, bei dem wir nach langen Arbeitstagen noch einige Gläser zu leeren pflegten. Hätte Johannes schon meine Bekanntschaft mit Georg, dem Regierungsrat, verab-scheut, wenn sie ihm bekannt gewesen wäre, wie widerwärtig wäre ihm erst gewesen, worüber man bei derlei Anlässen zu sprechen gewohnt war.
Georg erzählte aus seinem Privatleben, das mir ohnehin weitgehend bekannt war, aber das gab ich ihm nie zu verstehen. Er war mir als Mensch nicht unsympathisch – ich brauchte an ihn ja keine ästhetischen Maßstäbe anlegen wie Johannes und vor allem Sonja Maria -, ich fand ihn ganz unterhaltsam, und wenn mich etwas an ihm störte, war es sein Mangel an ideologischem und philosophischem Tiefgang. Er beneidete mich, weil ich nicht verheiratet war, und schilderte voll Selbstmitleid die Eskapaden seiner Frau, die seiner Ansicht nach das Geld mit vollen Händen ausgab und ihn gleichzeitig wegen seiner Interesselosigkeit, Faulheit und was weiß ich noch alles maßregelte. Es amüsierte mich, ihn in seiner ganzen Doppelbödigkeit vor mir zu sehen als hohen Beamten und Mentor anlehnungsbedürftiger Frauen einerseits und als geschundenen und getretenen Ehemann andererseits. Nichts geht mehr, sagte ich zu ihm, wenn es in der Part-nerschaft einmal so weit gekommen ist: man tastet sich vom Vergehen des einen zum Verstoß des anderen und findet den Anfang nicht. Da lobte sich Georg denn Sonja Maria, die er drei oder vier Mal die Woche sah – Freitag/Samstag/Sonntag verbrachte er daheim, und da hatte Sonja Maria Zeit für Johannes – denn dort gab es die erwähnten Probleme nicht. Weil keine Zeit zum Diskutieren bleibt, ergänzte ich, und weil die Klä-rung der Standpunkte immer hinausgeschoben wird. Und, setzte er von sich aus hinzu, weil man miteinander schläft und damit eine eigene Qualität der Beziehung schafft, die alles andere überdeckt: warum denn wirklich immer fragen, wie es weitergeht, und damit zuletzt sogar das verderben, was vorhanden ist? Scheinbar ist es so, sagte ich, aber woher willst du wissen, was es für eine Frau bedeutet, wenn du mit ihr schläfst, ich meine, wie willst du es wissen, wenn dir alles übrige an ihr gleichgültig ist?
Und du, fragte er ätzend, du weißt das alles natürlich? Nun, ich ahnte es zumindest, und ich war nicht darauf angewiesen, mit ihm oder mit anderen Männern diese augen-zwinkernden Gespräche zu führen, die beklagten, daß in einem bestimmten Stadium einer festen Bindung jedes auch nur alltägliche Wort zur Tretmine werden kann, aber darüber hinwegtäuschten, daß dafür noch immer ein Gefühl der Geborgenheit und des Dazugehörens vermittelt wurde. Das andere, worum Georg mich beneidete, dieses Nicht-Müssen oder Nicht-Können-Wollen, hatte natürlich ebenso seine Konsequenz, nämlich die Urangst ständiger Abschiede, von denen man nie genau wußte, ob sie end-gültig waren, und die Möglichkeit, aus allen Träumen zu fallen in einsam verbrachten Nächten.
Von der Utopie ewiger Liebe und unmißverständlicher Kommunikation, wie sie Johannes – neuerdings bestärkt durch J.C. – vorschwebte, war ich meilenweit entfernt. Dazu war meine Vorstellungswelt zu konkret und mein Begriff von Zuneigung zu stark am weibli-chen Geschlecht und noch stärker jeweils an einer bestimmten Frau orientiert. Aber auch zu Georgs Anschauung empfand ich eine mindestens ebenso große Distanz. Für ihn war Sonja Maria eine „klasse Katz'“ – wie man hierzulande sagt -, die er durchaus in einer Reihe sah mit den anderen, die sich im Verlauf seiner fast dreißigjährigen Ehe in sein Revier verirrt hatten, und da war ich wiederum viel zu idealistisch, um ihm hier folgen zu können.
—–
Wenn man das heute so liest, unterbricht der Verleger nachdenklich, was damals so geschrieben wurde – pardon, wenn man sich aufgrund Ihrer Schreibe wieder hineindenkt in unser damaliges Leben…
Noch war es nicht normal, daß unser Alltag von ferngesteuerten sexuellen Impulsen gelenkt wurde: zum Beispiel hingen noch nicht die Palmers-Titten aus jedem Wartehäuschen der Straßenbahn heraus. Aber was seither im Zuge der öffentlichen Sexualisierung geschah, ist lediglich die Herstellung völlig emotionsfreier Kunstfiguren, von Abziehbildern der echten atmenden, zitternden und schwitzenden Körper, denn die sowohl alltagssprachliche als auch poetische Impotenz gegenüber dem Bereich der Sexualität hat sich nicht verändert.
Dessenungeachtet kann man süchtig werden, Themelis. Wie mein alltägliches Leben von Ihren Sex-Impulsen perforiert wird, ergeht es mir beim Anhören von Schuberts H-Moll-Symphonie: ohne schwul zu sein, empfinde ich dieses Moment struktureller Unerfüllbarkeit – verstärkt durch die weibliche Gegenrevolution der Gorilla-Girls, die nackt mit Affenköpfen durch Museen sausten, um gegen die Negation der Frau im Kunstbetrieb zu protestieren und gegen die Objektfunktion des Femininen als Dargestelltes, gekoppelt mit der Vorstellung ständiger Verfügbarkeit des weiblichen Körpers.
Und das in einer Zeit, Herr Direktor, in der die ökonomische Hierarchie nicht nur beruflich (das ist ja heute noch so), sondern auch privat auf den Mann hin orientiert war.
——
Wenn es in den späten 60er Jahren eine wirtschaftliche Krise gegeben hat, bemerkte sie kaum jemand. Im Marxistischen Arbeitskreis, den ich ab und zu besuchte und dem sowohl Sozialisten als auch Kommunisten angehörten, diskutierte man, ob die Lohnabhängigen sich auf Dauer mit Bezugserhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen zufriedengeben und nie etwas anderes fordern würden. Als im Mai 1968 in Paris die Hölle los war und in den deutschen Städten die Demonstrationen der außerparlamenta-rischen Opposition liefen, sahen einige von uns die Situation, auf die sie gewartet hat-ten, auch im Sinne einer Zusammenarbeit der Linksparteien. Ich sagte ihnen allerdings, daß keine Arbeiter auf den Barrikaden standen: ich hatte es mit eigenen Augen gese-hen, als Revolutionstourist in Frankreich und Deutschland (so diskret war ich schon ge-worden, daß ich nur mehr zusah). Was dort rief „Zerstört den Staat!“, war jedenfalls nicht die Bewegung, die ich wollte. Mir fehlte die Zielvorstellung, aus der Erkenntnis der ökonomischen Grundlagen dem Teufelskreis der Manipulation zu entkommen.
In einer Sitzung des Arbeitskreises beschimpften wir einander als Salonkommunisten und Nadelstreifsozialisten, und alle waren überzeugt, daß sofort etwas geschehen müß-te. So entstand auch bei uns als Akt der Praxis jene – vorweg gesagt: mißglückte – Viet-nam-Demonstration, bei der wir einige Fensterscheiben der amerikanischen Botschaft einwarfen und schließlich allesamt (viele waren wir ja nicht) verhaftet wurden. Über Intervention unseres Parteivorsitzenden wurden wir Sozialisten umgehend auf freien Fuß gesetzt, kurz danach – um Aufsehen zu vermeiden – auch die Mitglieder der kleine-ren linken Gruppen. Abgesehen davon, daß vermutlich unsere Namen bis zum heutigen Tag die Annalen der Staatspolizei zieren, verlief gemütlich wie alles in Wien auch dieser Aufstand gegen das Establishment. Das lag wohl nicht zuletzt daran, daß Leute wie ich eigentlich hätten gegen sich selbst kämpfen müssen.
—–
Also stop! Der Verleger wirkt außergewöhnlich engagiert: Stichwort Viet-nam! Ich war erst kürzlich in Vietnam, Themelis, das glauben Sie einfach nicht, was ich dort erlebt habe! Als ehemaliger Kriegsgegner (später sagte man: Friedensbewegter) hofft man natürlich irgendwie, seine Jugend dort wiederzufinden, aber weit gefehlt – es wird einem geradezu eingebleut, wieviele Jahre seither schon vergangen sind!
Was haben Sie gesehen, Herr Direktor, was Sie so aufgewühlt hat? Mit den Leuten dort hat es offensichtlich nicht viel zu tun.
Also (der Verleger atmet durch): Wir Touristen wurden in das unterirdische Tunnelsystem des Vietcong geführt, einerseits natürlich eine rein physisch beklemmende Erfahrung – daß Menschen da unten jahrelang existiert haben. Andererseits die erstaunliche Beobachtung, daß diese Höhlen komplett ausgestattet waren, mit Küchen und Schlafräumen und Spital und sogar einem Saal für Versammlungen. Kann schon sein, meinte der Kriegsveteran und heutige Museumsführer, daß an einem bestimmten Tag tief unten ein populärer Sänger aus Hanoi (seinen Namen habe ich nicht behalten) aufgetreten ist, an der Erdoberfläche genau darüber im Hauptquartier der 25. US-Armeedivision aber zur gleichen Zeit Bob Hope in der Truppenbetreuung tätig war. Schon da war ich auf die Absurdität eingestimmt, die jede ursprünglich ernste historische Situation mit dem gewissen Abstand gewinnt. Vollends umgehauen hat mich dann die Erfrischungsbaracke, in die wir nach der Exkursion geführt wurden: Aus dem Lautsprecher tönte Elvis Presley mit „Put your head on my shoulder“, zu trinken gab es ausnahmslos Coca-Cola. Wollen Sie mir sagen, wofür dort eigentlich gekämpft wurde?
Der Kapitalismus muß seine Eroberungszüge der Privatwirtschaft überlas-sen, Herr Direktor – die ist erfolgreicher als das beste Militär!
Aber dann sind automatisch wir Pazifisten die Dummen, die gegen ein Phantom anstürmen.
Wir stellen uns ohnehin immer nur als nützliche Idioten zur Verfügung, und vor allem die ganze Gefühlskiste mit Dritter Welt und Entwicklungshilfe finde ich zum Kotzen. Der Letzte begreift inzwischen (und stellt sich damit in die Tradition Rosa Luxemburgs, ob er nun will oder nicht, vielleicht ohne es zu wissen), daß der Aufstieg der Industriegesellschaften in den letzten 200 Jahren wesentlich auf der Ausbeutung anderer Länder beruht. Die Trivialität der Einkommensunterschiede müssen wir als historische Einmaligkeit interpretieren, denn bis zur Industriellen Revolution waren alle Völker Ag-rarwirtschaften gewesen, mit durchaus vergleichbarer Produktionstechnik.
Und Sie meinen, die Intellektuellen hätten die Entwicklungsländer als Symbol für die zahlreichen Defizienzen des kapitalistischen Systems verstanden? Das hat gewiß etwas für sich, Themelis, aber wer läuft heute gegen den Kapitalismus Sturm, nachdem er gesiegt hat?
Er hat nicht gesiegt, Herr Direktor. Er ist übriggeblieben…
So plakativ es klingt, ist es doch eine grobe Vereinfachung. Das europäi-sche Erbe, das sich der Kapitalismus zunutze gemacht hat, ist die Rechtssicherheit für die Wirtschaft, ja geradezu die Ablösung der kommerziellen Sphäre von der Staatsgewalt: die Dispositionen von uns Unternehmern erfolgen weitgehend frei von öffentlichem Einfluß (sonst könnte man zum Beispiel nicht einmal im Traum daran denken, Ihr Buch zu veröffentlichen – was Sie übrigens noch nicht als Zusage interpretieren sollten!).
Und dennoch müssen Ihre Unternehmer verstehen oder besser neu verstehen lernen, daß sie ihre ganz großen Gewinne nicht in der Zeit des hochkapitalistischen Massenelends, sondern in der des Massenwohlstandes gemacht haben, und dieser ist nun einmal eine Funktion des sozialen (und damit zutiefst politischen) Korrektivs der Marktwirtschaft. Kurioserweise hat einer der Urahnen Margaret Thatchers in der Parteivergangenheit der Tories gegen das schrankenlos-liberale Unternehmertum die ersten Sozialgesetze erlassen.
Dann bleibt uns als Synthese die (pessimistisch gesprochen) Kreis- oder (etwas optimistischer) Wellen-Bewegung der Geschichte…
… oder zumindest die Erkenntnis, daß die Historie mehr ist als ein Schnörkel am Gebäude der Sozialwissenschaft.
xxxxxxxx
D
ialektisch ist alles begreifbar, wie uns ein Gastreferent im Arbeitskreis belehrte: Der Marxismus-Leninismus habe keine Dogmen, sei gar nicht zu definieren, bringe jedem das Seine, selbst für extreme Typen wie Stalin und dessen Wegbereiter. Was für die Begründer die Analyse objektiver Tatsachen sei, werde für die Nachfolger zum Fun-dament eigener Sicherheit. Es sei daher erforderlich, von den Auswüchsen – den gleichwohl für den einzelnen oft tödlichen Umarmungen – des Systems abzusehen.
Viel einfacher als die Praxis auf ihre Bedeutung (auch im marxistischen Sinn) zu unter-suchen, erschien dem Arbeitskreis die, wie ich es nannte, sich selbst reflektierende Dis-kussion. Als ich im Polizeigebäude auf meine Einvernahme wartete, dachte ich an die begrifflichen Schwierigkeiten, die selbst im ideologisch geschulten Kreis bei Fragen wie diesen auftraten: Sind in jedem Menschen bei seiner Geburt völlig gleichartige und gleichwertige Fähigkeiten angelegt und werden die Individuen ausschließlich durch ihre Umwelt ausdifferenziert? Oder besteht der revolutionäre Schritt nicht vielmehr darin, die zweifellos bestehenden Unterschiede als nichtig zu erklären? Oder ist womöglich der Sozialismus mit seinem unnatürlichen Altruismus doch nur (wie es auch dem Christen-tum vorgeworfen wird) eine gut getarnte Übervorteilung der Stärkeren durch die Schwächeren?
Plötzlich hörte ich eine laute Auseinandersetzung in der Gruppe der Festgenommenen. Johannes, der die Fenster der Botschaft ehrlichen Herzens demoliert hatte, rief J.C. zu, er solle den Mund halten und den Beamten gegenüber die Demonstration keineswegs als Ereignis im Erlösungsplan darstellen. Ihm schwante, daß J.C. darauf vorbereitet war, die Rolle eines Mannes zu spielen, der dem Pilatus (in der Verkleidung des vernehmen-den Polizeijuristen) mitteilte, wozu er in die Welt gekommen sei. Gerade weil ich ihm und den anderen Demonstranten schon gesagt hatte, daß ein befreiender Anruf von höherer Stelle bevorstünde, war Johannes einzig und allein darauf bedacht, aus der ganzen Sache ungeschoren herauszukommen. Schließlich war die Polizei sehr geschickt darin, aus der Revolution einen Hausfriedensbruch und aus den Demonstranten für die große Sache banale Vorbestrafte zu machen. J.C. wollte sich aber nicht von seinem Vorhaben (und vor allem nicht von seiner Aufführung) abbringen lassen und betonte, daß er nur aus Liebe zu Johannes an der Demonstration teilgenommen hatte: mit ihr habe sich schon ein Stück von dem erfüllt, was geschehen sollte: Mörder! schrie er die bis dahin stumpf dösenden Polizisten an, die uns bewachen sollten. Mordbande! Legt eure Hände in die Seite des Gesalbten und glaubt endlich, nein, überzeugt euch, daß die Todeswunde bereits geschlagen ist. Euer Sieg ist eindrucksvoll, unüberbietbar, in eurer dreidimensionalen Welt schlechthin vollkommen.
Glücklichweise kam in diesem Moment das rettende Telephonat, und wir wurden ohne weitere Formalitäten entlassen. Dem Polizeioffizier, der mich beiseite nahm und fragte, ob er einen Arzt holen lassen sollte, sagte ich, daß ich mich selbst um J.C. kümmern wolte. Ich dankte und versicherte, daß ich dieses Maß an Zuvorkommenheit im Ge-spräch mit meinem Parteivorsitzenden besonders hervorheben würde. Johannes und ich verließen das Gebäude mit J.C., der nunmehr ganz ruhig war. Ihr versaut die Erlösung, sagte er nur leise, bevor er sich auf der Straße von uns verabschiedete. Claudia, von ihrem Bruder verständigt – womit sich wieder einmal erwiesen hatte, wie rasch die Kommunikation über Parteigrenzen hinweg funktionierte -, wartete bereits auf mich. Daß Johannes und J.C. an der Demonstration teilgenommen hatten, wunderte sie nicht, aber wie war ich auf die Idee gekommen, solchen Unfug zu machen? War das nicht ein etwas verspäteter Ausbruch von Pubertät, insgesamt etwas lächerlich?
Ich reagierte zunächst ziemlich patzig mit sachlich klingenden Argumenten, bei denen mir allerdings, während ich sie noch aussprach, ihre Phrasenhaftigkeit zu Bewußtsein kam, und ich stockte schließlich mitten im Satz. Ich liebe dich doch, du Narr, sagte Claudia. Da stieg die alles einhüllende Wärme der Kindheit wieder in mir auf, und ich dachte, wie gut es gewesen wäre, wenn die Frauen die Helden schon immer zärtlich daran gehindert hätten, ihr sinnloses Handwerk auszuüben. Ich küßte Claudia und sag-te, daß die politische Auseinandersetzung zwischen uns beiden ausgestanden sei. Jo-hannes blickte staunend, als wir Hand in Hand davongingen. Er könnte daraus lernen, dachte ich, daß männliches Besitzstreben sich in körperlicher Gemeinsamkeit manifes-tieren kann und nicht durch äußerliche Gewaltakte sublimiert werden muß.
J
.C. war im breiten Spektrum seines Daseins ein ganz durchschnittlicher Mensch. Es war bloß so, daß sich seine Sensibilität nur schwer in die Bedürfnisse des praktischen Reglements einordnen ließ. Früh wurde seine Geduld durch eine schwere Krankheit auf eine harte Probe gestellt, die er bestand, indem er seinen Körper mit eiserner Disziplin bezwang. Den Sinn des Leidens und der Entsagung suchte er allerdings nicht darin, bewußter den Alltag, sondern darin, bewußter die Utopie zu leben. Er erlaubte sich nichts, was die Spannung zwischen diesen Polen hätte wenigstens vorübergehend lo-ckern können: stolz erzählte er zum Beispiel Johannes, daß er nicht nur seinen Leib be-siegt hatte, sondern sich auch die Ausübung seiner schauspielerischen Talente für immer untersagt hatte (was ohnehin nicht zutraf, denn er spielte seine Rolle gut). Dem-entsprechend kam er auf seinem theatralischen Weg zur Grenze der Loslösung von allem zur Erkenntnis, auch ohne Identität leben zu können.
Er hatte das Mindestmaß an Identität allerdings nie besessen. Sein durch das Rollen-studium bei der Mitwirkung an einer Kleinbühne vortrefflich trainiertes Gehirn konnte Texte geradezu aufsaugen, und J.C. gab diese wieder, als wären sie seine eigenen Ge-danken und Gefühle. Unmerklich für andere glitt er ins Zitat, unmerklich wieder heraus. Die ältliche Schauspiellehrerin, die selbst ruhmlos geblieben war, erkannte in ihm unter allen Schülern mit sicherem Blick das Instrument, mit dem sie ihre Konzepte realisieren konnte, vor allem jenes vom weltzerstörenden, den Schöpfer verhöhnenden Mephisto, der mit übersteigerter Stimme und Gestik das Publikum ansprang. Für J.C. entwickelte sich daraus in langen Nächten das Bewußtsein einer Versuchung, die ihn ebenso gut zum Verbrecher wie zum Heiligen führen mochte: ganz so, als ob dieser Dualismus der Seele in seiner Person zum ersten Mal seit Bestehen der Welt aufgebrochen wäre, so als ob die Lossagung oder die Unterwerfung einmal endgültig und nicht immer wieder von neuem geschehen müßte.
Nachdem er mit ganzem Einsatz den Teufel verkörpert hatte und mit ihm tief in die Schwermut der Negation gesunken war, gab es für ihn nur noch eine Steigerung: die Rolle des Messias, und diese nicht mehr nur im Kellertheater, sondern vor der ganzen Welt. Wie wir es alle bis zu einem bestimmten Grad tun, vergewaltigte er sich selbst in der Grundverwirrung zwischen dem, was wir zu sollen oder zu müssen glauben, und dem, was wir wirklich sollen und müssen. Gott und den Menschen wollte er alles sein, ohne jemals zu fragen, was jener oder diese von ihm wirklich erwarteten, ohne auch nur zu fragen, wieviel vom Menschen in Gott steckt und (vielleicht) umgekehrt. Es erstaunte mich nicht, daß viele Leute seinem Blick nicht standhielten, ihm aber war es ein Zeichen von Auserwählung.
Die Erlösung – diese seltsame, sich durch die Jahrtausende ziehende Hoffnung auf eine neue Erde – war, so schien es J.C., schon immer in ihm gewesen. Seiner Umgebung hingegen mußte klar sein, daß er etwas vor sich hertrug, was ihn über kurz oder lang aus der Realität katapultiueren würde. Ergreife einen Beruf, riet ihm ein wohlmeinender Pragmatiker (das hätte ich sein können, aber da kannte ich ihn noch nicht) in der Ab-sicht, diesen verstiegenen Geist auf die Erde zurückzuführen und durch einen tätigen Alltag zu heilen. Allerdings war J.C. nicht bereit, die restlichen Jahre seines Lebens un-spektakulär in einem ganz gewöhnlichen Job zu verbringen. Er setzte sich zunächst über die anempfohlene Demut hinweg, und es ereignete sich der schon berichtete Vorfall. Aus seinem hinter der Welt befindlichen Unterbewußtsein löste sich der Schrei, von dem er selbst annahm, er müßte durch die Mauern hindurch überall hingedrungen sein.
Erschöpft ging er danach durch die Straßen, wollte jedem, dem er begegnete, in die Augen sehen, aber die Leute hatten es eilig, schauten weg. Seine Füße schienen ihm über dem Boden zu schweben, und er betete für die Vorüberkommenden, ohne sichtba-res Ergebnis. In den nächsten Tagen wuchs in ihm, was er als einen heiligen Zorn emp-fand, und er versuchte, den anderen ein Spiegel ihres Verhaltens zu sein, eine krasse Reflexion ihrer Gemeinheiten – doch keiner erkannte sich in ihm. Nun schien es ihm selbst, als sei sein Schrei ins Leere verhallt. Als er sich wieder entschloß, die ihm selt-sam spröde gewordene menschliche Sprache zu benützen, scheiterte J.C. erst recht. Ernannte sich einen Titanen, der den Panzer aus Eis sprengt, gab sich damit dem Ge-spött preis. Der einzige, der dieses Phantombild nicht belächelte, war vorerst anschei-nend Johannes.
Die Thematik des Blicke-Standhaltens, Themelis (wie bereits öfter, klam-mert sich der Verleger an einen Randaspekt): mystisch nur für den, der die zugrundeliegende Kulturtechnik nicht kennt.
Sie meinen, man müsse da nur ein einziges Mal durch, etwa in einem von Claudias Seminaren für Kommunikationstechnik, wo sie eine Frau und einen Mann einander gegenübersetzte, und die mußten sich fünfzehn Minuten lang tief und regungslos in die Augen schauen. Nach der vielleicht längsten Viertelstunde ihres Lebens hatten diese bunt zusammengewürfelten Pärchen das Gefühl, miteinander geschlafen zu haben – eine nicht beabsichtigte Nebenwirkung, aber der Zweck war erreicht.
Was Sie da sagen, bestätigt nur die Theorie, daß die Nacktheit des Auges jeden sonstigen Exhibitionismus übersteigt. Die Kamera von Christine Breillat zeigte es exemplarisch: ihr Film „Romance“ ist so sexistisch, daß er selbst die Mindestanforderung der Pornographie zerstört – er erregt nicht, erweckt keine Lust, ist einfach kalt…
… und führt mitten ins Zentrum menschlicher Triebhaftigkeit, Herr Direktor, wo man eisig beobachtet statt zu tun. Daher sollte man sich auch Friedkins Film „The Night They Raided Minsky’s“ wieder ansehen, in dem der puren Lust des unbelasteten Betrachters ein phänomenales Denkmal gesetzt wurde: Ein streng erzogenes Amish-Mädchen geht nach New York und erfindet, ohne wahrscheinlich zu wissen, was sie da anstellt, den Striptease.
Korrigiere, Themelis – ihr Verstand hat’s nicht gewußt, dafür aber die da-runterliegenden Körperpartien. Jedenfalls: Es lebe die pluralistische Gesellschaft – erst wo es Tabus gibt, wird die Frivolität zum Genuß!
C
laudia begleitete mich, als ich in die Parteizentrale beordert war, um mich für die Teilnahme an der Vietnam-Demonstration zu rechtfertigen. Da wir genügend Zeit hatten, spazierten wir langsam die Ringstraße entlang und saßen dann ins Café Landt-mann (wo Claudia anschließend auf mich warten wollte). Sie ließ sich die Einzelheiten des Vorfalls im Polizeigebäude berichten, und nach einer Pause brach es aus ihr hervor: Verschont uns Frauen mit einem Messias, der dieser männlichen Religion noch mehr emotionale Triebkraft verleiht! Immer wenn Männer vor Entscheidungen stehen, die über das rein Alltägliche hinausgehen, hin zur einzigartigen, unverwechselbaren Ver-antwortung des eigenen Lebens, versteigen sie sich in weiß was für Ausflüchte: einge-bildete Krankheiten, Arbeitsorgien, Kriege womöglich oder eben in die letzte Sublimati-on – den Erlöserwahn. Wenn man Pasolinis „Teorema“ gesehen hat, weiß man wie das läuft: der junge Mann, der die ganze Familie glücklich macht, der mit der Mutter, der Tochter und der Hausangestellten, nicht zu vergessen aber auch mit dem Vater und dem Sohn schläft, bildet eine entlarvende Parodie der umfassenden Erlösung, die das Individuelle, die Exklusivität einer Partnerschaft völlig verdrängt und mit dem klebrigen Brei der Harmonie übergießt. Fast müßig zu erwähnen, daß der ganze Flitter verfliegt, wenn der schöne Jüngling weggeht, um einen anderen Haushalt zu verklären.
Die Wahrheit lag für Claudia darin, daß wir Steinzeitmenschen sind, die in die Gegen-wart der Industriegesellschaft hineindegenerieren, nachdem unsere natürlichen Instink-te den technologischen Sachzwängen unterworfen worden sind: innerlich noch immer gefangen in den archaischen Schaltkreisen, die unsere Reflexe steuern, äußerlich invol-viert in ein von der Biologie losgelöstes Sozialsystem: also zum Beispiel in diese Situati-on der Apartheid, in der die Männer die Frauen kurzweg als zweitklassig einstufen. Dennoch war Claudia keine Verfechterin einer Vermännlichung der Frau, schon gar nicht ohne gleichzeitige Verweiblichung des Mannes. Viel wesenhafter war es für sie, sich über die Fanatisierung der Sexualität klar zu werden, die doch offenbar von den scheinbaren Moralisten ausgelöst worden war, um sich der Aggression der Unbefriedig-ten ebenso bedienen zu können wie der Haltlosigkeit der Ungezügelten.
Ich mußte an die Wirkung denken, die Claudias Worte in den konservativen Kreisen auslösen würden, denen sie entstammte. Ich lächelte, sagte aber nichts, da ich in die-sem Augenblick an nichts weniger als an einer neuen Front unserer politischen Ausei-nandersetzung interessiert war. Sicher ist es schwer, sagte ich (als ich bei meiner Part-nerin eine gewisse Gereiztheit wegen meines Lächelns feststellte), eine Position zu fin-den im Dreieck von reiner Sachbezogenheit, Schöpfertum und Zelotismus. Und darüber stülpt sich noch die alles zusammenfassende Kontinuität unseres Bewußtseins: wir selbst, in jedem Augenblick wir selbst, bei allen Facetten, die wir nach außen aufweisen mögen. Wir sind eben nicht bis ins letzte fähig, unsere eigene Inkonsequenz wahrzu-nehmen – könnten wir es, würden wir die Grenze zur Schizophrenie (oder nenn es wie du willst) überschreiten. Wie es J.C. getan hat, antwortete Claudia, ein Weltheiland, umgeben von banalem Alltag.
Warum eigentlich nicht, dachte ich, hat doch keinerlei Folgen für den Lauf der Welt, normalerweise jedenfalls nicht. Was Claudia sagte, entsprang ihrer persönlichen Erfah-rung mit J.C., den wir zwischen der Demonstration und meiner Vorladung in die Partei-zentrale einmal bei Johannes getroffen hatten. Nach einem kurzen Gespräch, das vor allem von Claudia recht realistisch geführt wurde und an dem sich eben deshalb J.C. nicht beteiligte, war dieser schweigend weggegangen: weil ich nicht, kommentierte meine Freundin, seine Aura des Geheimnisvollen anhimmle wie es offenbar die meisten anderen Frauen tun, und weil man seiner Ansicht nach mit Frauen nicht reden kann, die immer allem auf den Grund gehen wollen und immer Erklärungen und womöglich sogar Lösungen bereit haben wie etwa die, daß einer nicht immerfort vor der konkreten ge-schlechtlichen Umarmung fliehen soll. Danach schwiegen wir.
Nun geh schon zu Deinem Bonzen, sagte Claudia, als die vereinbarte Stunde näherrück-te. Kurz spürte ich den Stich, den solche Bemerkungen stets bei mir hinterließen, wollte entgegnen, daß in der Partei ihres Bruders ebenfalls … und daß es nahezu unmöglich geworden sei, die beiden Typen auseinanderzuhalten … aber zu welchem Ende?
Man denkt an dieser Stelle unwillkürlich an Franz Olah, Herr Direktor. Ihm könnten wir hier ein – wenn auch widersprüchliches – Denkmal setzen.
Wer soll nun das wieder sein, Themelis?
Nun, wer ihn gar nicht kennt, dem kann man ihn schwer beschreiben: Der weiland Innenminister und Gewerkschaftschef in einer Person. Damals der einzige Politiker, der es mit peronistischem Gepränge und ebensolchem Widerhall in der Bevölkerung in der Hand gehabt hätte, die ganze, wirklich die gesamte Macht an sich zu reißen und die Republik Österreich in einen neuen Staat umzuwandeln.
Darüber brauchen Sie sich aus heutiger Sicht nicht mehr aufregen, da es ein anderer geschafft hat, wenn auch auf einem teilweise anderen Nährboden.
Aber worüber regt man sich dann noch auf?
Warum ist Ihnen dieser Olah so wichtig?
Weil sein Leben anders als unsere eigenen Erfahrungen der 60er Jahre geradezu ein Filmstoff ist: gelitten in Gefängnissen und Konzentrationslagern bis 1945 für den puren Kern seiner sozialistischen Gesinnung, danach in zwanzig Jahren aufgestiegen in eine beispiellose Höhe jenseits der verfassungsmäßigen Konturen seiner Ämter, 1964 im Endeffekt widerstandlos gestürzt und politisch völlig demontiert.
Man hat also die freiwillige Zurückhaltung dieses Volkstribunen nicht be-dankt?
Im Gegenteil, in einem banalen Gerichtsverfahren wegen eines zwielichtig verwendeten Betrages von einer heute lächerlich klingenden Million Schilling aus der Gewerkschaftskasse wurde er 1969 zu einem Jahr Haft verurteilt, endete dort, wo er in der Ersten Republik begonnen hatte, als Ausgestoßener des Systems.
Aber man durfte solche Leute nicht schonen, Themelis. In der Demokratie mußte die Ethik vor der Opportunität kommen.
Sie verwenden das Imperfektum zurecht, Herr Direktor. Auch die damali-gen Führer der SPÖ dachten in Wertmaßstäben der strategischen Mitver-gangenheit. Machen wir also weiter. Die Zukunft liegt quasi noch vor uns.
U
nser alter Parteivorsitzender empfing mich freundlich, wenngleich mir die Augen hinter den dicken Brillengläsern traurig erschienen. Du weißt, setzte er zögernd an, daß ich viel für dich übrig habe. Kunststück, fiel ich ihm gleich ins Wort, so viele sind wir nicht mehr, die offen auf deiner Seite stehen. Du weißt eben deshalb, fuhr er fort, daß es in der Partei Leute gibt, die mir voll Vergnügen Dinge berichten und mich zwingen wollen, gegen dich vorzugehen. Er blätterte in Papieren und zählte dann auf: Zusammenarbeit mit Kommunisten – Teilnahme an gewalttätigen Demonstrationen – und den, der im Polizeigebäude Erlösung gerufen hat, kennst du wohl auch? Ich nickte langsam, und er sagte scharf: Das geht nicht! und nach einer Weile leise: Das geht doch nicht.
Aus mir brach plötzlich brutal eine tief verschüttete Aggression gegen alle älteren Män-ner, gegen Väter, Lehrer, Kompromißler, Verhinderer, Verzögerer hervor, notdürftig verkleidet in politische Sachlichkeit: Wozu habt ihr eigentlich gegen die Faschisten ge-kämpft, wenn ihr jetzt bei Staatsbesuchen diesen Johnsons, Breschnews die Hände schüttelt, nur weil sie in der scheinbaren Untadeligkeit ihrer ehemaligen Anti-Hitler-Allianz dastehen? Und wer wehrt sich gegen die reingewaschenen Nazis in den hohen Stellungen? Und wer macht etwas gegen den aufkommenden Rechtsradikalismus? Und wer vergißt ganz auf die Veränderung der Gesellschaft, weil man dem ehrenwerten So-zialpartner nicht auf die Zehen treten möchte? Und wer glaubst du wird dir noch gegen quirlige Pragmatiker in der eigenen Partei helfen, wenn du ihnen ohnehin in allem nachgibst?
Du bist zu jung, sagte er tonlos, um zu wissen, welche Verpflichtungen wir nach dem Krieg und insbesondere 1955 eingegangen sind. Die Welt, die Gesellschaft, der Staat, das Leben, alles ist eingeteilt und aufgeteilt. Ja, wir sind nichts anderes als Marionetten der Großmächte, und die in Washington und Moskau sind selbst wieder nur Sachwalter der Leere, des großen Nichts.
Aus dem Zustand, in den mich seine Worte versetzt hatten, erwachte ich erst wieder in Claudias Wohnung. Kaum daß ich wußte, wie ich ins Café gekommen, sie abgeholt, mit ihr nach Hause gefahren war. Ich ging im Wohnzimmer auf und ab und versuchte, mir alles genau einzuprägen, den Gegenständen wieder ihre normale Bedeutung zuzumes-sen. An der Wand hingen selbstgemalte Bilder, Illustrationen zu Edgar Allen Poe. Durch das Fenster sah ich die Floridsdorfer Hauptstraße, ein Haustor, eine Telephonzelle, von der aus, wie ich wußte, Johannes öfters Sonja Maria angerufen hatte. Es gab etwas zu essen, Wein, Kaffee, und dann wollte ich mit Claudia schlafen und konnte nicht, erst-mals im Leben total aus dem Kostüm des Machers gefallen.
D
as Gespräch, das zwischen Claudia und Sonja Maria stattgefunden hatte, war nicht dazu angetan gewesen, irgendetwas von dem zu verhindern, was offenbar geschehen mußte. Claudia traf Sonja Maria eines Nachmittags auf der Kärntner Straße und sprach sie an. Sie hatten einander seit dem Ball nicht mehr gesehen, und Claudia war nicht sicher, ob Sonja Maria, die schlafwandlerisch dahinging, sie überhaupt gleich erkannte. Nachdem die beiden noch eine Weile durch die Innere Stadt geschlendert waren und Schaufenster angesehen hatten, fuhren sie nach Hause, und Claudia lud Sonja Maria zu sich ein. Als sie nebeneinander saßen und Tee tranken, überkam Claudia ein, wie sie mir sagte, mütterliches Gefühl, ein Bedürfnis, die steif und verschlossen wirkende Sonja Maria zu umarmen, irgendwie deren Panzer zu sprengen, einen vielleicht vorhandenen Tränenschwall auszulösen, um danach zum Wesentlichen vordringen zu können. Aber Sonja Maria weinte nicht, selbst als Claudia über ihr Haar strich.
Ich weiß, was du willst, sagte Sonja Maria, daß du mir Gelegenheit gibst, mich auszu-sprechen. Ich bin vielleicht eine Gans, aber es ist für mich äußerst schwierig, über das alles zu reden. Wenn es auch modern ist, muß es deshalb nicht immer sinnvoll sein, und ich habe Angst davor, was dabei herauskommen könnte. – Claudia, die in solchen Situationen leicht die Geduld verlor, schob das Gefühl von Zärtlichkeit beiseite und fuhr Sonja Maria an: Mach doch den Mund auf, stell dich nicht dümmer als du bist! Wie lange willst du das noch mit dir herumschleppen?
Georg ist professioneller, sagte Sonja Maria nach langem Zögern, und Johannes ist interessanter, aber auch seltsamer. – Was heißt denn professionell, um Himmels willen, fragte Claudia. – Nun, zum Beispiel, wenn man mit ihm irgendwohin kommt, ist er sofort der Mittelpunkt, und ich als seine Begleiterin werde automatisch beachtet, ohne etwas sagen zu müssen. – Wo kommst du denn mit ihm schon hin? In seinem Bekanntenkreis kann er sich mit dir gar nicht sehen lassen, wahrscheinlich selbst nach einer Scheidung nicht. Im Grunde wandert ihr ziellos von einem Lokal zum anderen, und wenn dein Vater nicht zu Hause ist, kannst du Georg mit in deine Wohnung nehmen, sonst bleiben euch mehr oder weniger romantische Absteigen. Und damit kommen wir zum entscheidenden Punkt: wie ist er im Bett? Was hat er an sich, daß du offenbar nicht von ihm loskommst?
Da gilt das gleiche, meinte Sonja Maria schroff. – Du meinst, der Ältere ist vielleicht langsamer und tiefgehender, der Jüngere rascher und oberflächlicher, aber das ist auch beider gutes Recht. Der Unterschied ist eigentlich der, daß Johannes dich so braucht wie du möglicherweise ihn. Kannst du das von Georg auch sagen, oder weißt du insge-heim ohnehin, daß du für ihn nur eine Frau bist, das heißt in gewissem Sinne irgendeine Frau, die jedenfalls noch immer über seiner Reizschwelle liegt. Für Johannes aber bist du du selbst, unverwechselbar und unauswechselbar, genau diejenige, die er jetzt anstrebt, nachdem sich aus dem pubertären Dschungel von blond und braun und mollig und schlank und groß und klein eine konkrete Wunschgestalt abgehoben und in dir per-sonifiziert hat: ein Wesen, das er nicht nur ansehen und anfassen, sondern dem er sich ganz öffnen möchte.
Claudia erwartete an dieser Stelle gar keine Meinungsäußerung von Sonja Maria. Sie überlegte, wie sie das Kommende formulieren sollte. Weißt du eigentlich, fragte sie dann, wie lächerlich kurz dieser Zeitraum in jedem Leben ist? Wenn er ungenützt ver-streicht, kommt umso rascher jener Prozeß in Gang, der alles zur Routine macht, selbst die intimen Zweisamkeiten, bis dann am Ende jener Typ Mann herauskommt, der alles reiflich überlegt hat und alles weiß und alles kann: für den eine Frau nichts anderes ist, als du für Georg bist.
An diesem Punkt der Unterhaltung stand Sonja Maria abrupt auf und verabschiedete sich. Ich hätte es an ihrer Stelle genau so gemacht, wenn ich ehrlich sein soll. Mir wur-de Tage später noch schwindlig von den Aussagen Claudias, als sie mir davon erzählte. Was hilft die messerscharfe Analyse fürs praktische Leben, entfuhr es mir: schon war es zu spät, diese Bemerkung hinunterzuschlucken. – Freut mich sehr, das von einem ge-eichten Marxisten zu hören, konterte Claudia. Es handelt sich also doch nur um ein Hemd, das über das wirkliche Ich gezogen ist! Was ist dann noch wahr: heute? mor-gen? und übermorgen?
Mir kam der Gedanke, daß unsere politischen Diskussionen zu unrecht aufs Eis gelegt worden waren, daß es doch nicht möglich war, zwischen weiten Teilen unseres jeweili-gen Innenlebens einen Waffenstillstand einzuhalten, nur um den Austausch der Gefühle nicht zu gefährden. Geht es noch um Georg, Sonja Maria, Johannes oder weiß ich wen, fragte ich Claudia unvermittelt, oder geht es bereits um dich und mich? Claudias Ge-sichtszüge glätteten sich, sie zeigte mir ihr herzliches Lächeln, und ihre blank geworde-nen Augen gaben mir zu verstehen, daß sie meine Zärtlichkeit fühlen wollte. Komm, tu’s doch, lockte sie. Ich zögerte einen Moment und fragte: Wie ist das möglich? – Es ist möglich, Gott sei Dank, antwortete sie: Es ist möglich, solange wir es nur selbst zulas-sen.
J
ohannes fühlte sich ziemlich tot, und sein Weg führte ihn wie üblich noch in der Nacht zu mir, um mir alles zu erzählen. Es schien ihm nicht mehr möglich, völlig verzweifelt zu sein. Der Arzt stellte eine leichte, aber akute Herzschwäche fest, und Johannes mußte sich für längere Zeit schonen. Ich gab ihm den trockenen Rat, Sonja Maria zu ver-gessen.
In seinen Krankheitsphantasien schrieb Johannes: Ich trage den Namen des freundli-chen Jüngers und des düsteren Sehers von Patmos. Aus dem Schnee am Kilimandscha-ro, in dem ich getröstet liegen möchte, beginne ich in meiner Euphorie zu fliegen. Durch das Konzerthaus dröhnt der elektronisch verstärkte Klang des Voilà je t’aime, und sie hält meine Hand: Liebe, Liebe, ich liebe dich, ich gehöre ganz dir, so sehr liebe ich dich. Stöhnen und gebrochene Augen stürzen auf meine Sinne ein, verwoben in die elemen-tare Frage meiner eigentlichen Identität. Wer kennt mich? Wer weiß, daß ich gern an einem Sonntagnachmittag dem Leben in Luxus erliege, wenn mich der Anblick durchsichtiger Bikinis in Ekstase versetzt? Ich gehe schwimmen mit einer Kaffeehausbe-sitzerin, räkle mich mit ihr am Strand, werde dabei bewacht von den Raketen der Großmächte. An den Kreuzungspunkten meines Bewußtseins begegnen einander Päpste und Beatles: weiß wie die Unschuld und schwarz wie die Anarchie.
Nachts träume ich manchmal, ich hätte den Modus vivendi gefunden, doch am Morgen habe ich ihn vergessen. Dagegen erinnere ich mich lebhaft an die charakteristischen Schornsteine einer Brauerei, unter deren Silhouette ich in einem Vorstadtlokal tanzen lernte. Festzuhalten ist weiter, daß ich am Tag, an dem Sonja Maria eine ihrer Ge-schäftsreisen machte, im Stadion ein Fußballmatch besuchte – niemals zuvor und nie-mals danach war ich dort. Und ferner, daß ich nie einen Mann so geliebt habe wie Thomas, der sich sein Gehirn wunddenkt über mich. Vielleicht sollten wir einander ein-mal verprügeln, damit wir zur Besinnung kommen: als wir Buben waren, hat es doch immer genützt.
In diesem Augenblick wäre ich gern in Kalifornien, weil sie im Radio eben singen, daß es dort den blauesten Himmel gäbe. Aber auch die farbigen Punkte und Kreise, die in meinen Augen schwirren und mich an die Photographie einer Platinspitze durch ein Fel-dionenmikroskop erinnern, sind sehr ästhetisch. Oder die Sphärenmusik von „Hair“, die ich zum ersten Mal in der Wohnung meines Freundes hörte. Hätten wir auf einem frem-den Stern gelebt, wären wir vielleicht glücklich gewesen. Ich liebe die Milchstraße und Planeten, die um große rote Sonnen kreisen. Ich wäre manchmal gerne tätowiert wie der Held des Films „The Illustrated Man“: mit einem leeren Fleck Haut auf dem Rücken, in dem man am gespenstischen Lagerfeuer seine Zukunft erblicken kann: das Leben in einer Unterwasserwelt – eine Beleuchtung für große Vorgänge. Atome bestehen aus einem Nichts an Materie: wo befindet sich eigentlich das, was uns quält? Und wo ist das Glücksgefühl, das uns oft so unmittelbar überschwemmt und den Alltag mit seinen Läs-tigkeiten fortspült? Ich höre J.C. an, folge ihm aber nicht nach. Ich bin ganz gefangen im legitimen Streben: noch alles erleben zu wollen.
A
ls er wieder einigermaßen gesund war, ging Johannes täglich in eine Disco namens „Voom Voom“. Es war die Zeit, in der man dort „Renaissance“ zu spielen begann: über die an der Decke kreisförmig angeordneten Lautsprecher, im rotgelbgrünblauviolett wechselnden Licht. Das war besondere Musik für eine Generation, die sich besonders fühlte: mit Worten nicht wiederzugeben – man spürte in sich den heimlichen Traum, statt der Sprache oder mindestens neben der Sprache diese Ausdrucksmöglichkeit zu besitzen, und wenn es gleich eine Flucht ins Uferlose gewesen wäre. Selbst mir war klar, was Johannes meinte, wenn er das Schallplattencover interpretierte: eine Stadt, bestrahlt vom verglühenden Ikarus, Umwandlung der trägen Substanz in Energie, Lösung der verstrickten Zwänge, Übergang von einer Existenz in die nächste, Ver-nichtung des alten, Aufbau eines neuen, mit gewaltigen Impulsen funktionierenden Seins: klingt irgendwie faschistoid, dachte ich bei mir, die immer wiederkehrende, für mich schreckliche Vision des neuen Menschen, nein des Übermenschen.
In der Höhle des „Voom Voom“, in der mit allen Mitteln versucht wurde, das Dasein zu bewältigen, in der Drogen gehandelt und konsumiert wurden, in der die bewußte Musik aus den Lautsprechern kam, tanzte Johannes mit Anita (sie hatte ihm beiläufig ihren Namen genannt). Als Johannes Zigaretten kaufen ging, folgte ihm ein Mann, der ihn schon die ganze Zeit mit verkniffenem Gesicht beobachtet hatte. Laß die Finger von ihr, sagte er zu meinem Freund. Dieser reagierte nicht, wollte ausweichen. Er wurde von mehreren Händen gepackt – zwei Begleiter des Fremden waren in Erscheinung getreten – und die Treppe, die zur Tanzfläche führte, hinuntergestoßen. Wer die drei eigentlich waren, hat Anita nie jemandem von uns erzählt.
Während der Lokalbesitzer die Polizei anrief, stürzte sich Anita über Johannes, streichel-te und küßte ihn. Als sie ihn fragen wollte, ob er verletzt sei, stand er bereits wieder auf (die Kindheit in den Ruinen hat uns abgehärtet, lächle ich in mich hinein, während ich dies schreibe). An zwei Polizisten, die gerade hereinstürmten, vorbei strebten sie im allgemeinen Trubel dem Ausgang zu. Draußen sahen sie noch, wie einige andere Besu-cher die Handbremse des Polizeifunkwagens lösten, sodaß dieser die Straße hinabrollte und gegen eine Hausmauer der Quergasse prallte. Aber Anita und Johannes kümmerten sich nicht darum. Gehen wir zu mir, sagte sie.
An Einzelheiten ihrer kleinen Wohnung hat Johannes sich später kaum erinnern können. Es stellte sich heraus, daß Anita eine kleine Rolle in der Wiener Aufführung des Musicals „Hair“ spielte und an diesem freien Abend tanzen gegangen war. Johannes, der aus-nahmsweise davon absah, von seiner unglücklichen Liebe zu erzählen, hatte von dem Stück bis dahin lediglich die Musik gehört und fragte Anita nach der Bühnengestaltung. Als er erfuhr, daß sie nackt auftrat, wollte er um ihre Empfindungen dabei wissen.
Da solltest du mich eher danach fragen, was ich dabei empfunden habe, als ich in Deutschland als Striptease-Tänzerin arbeitete, sagte sie: Das war eine andere Art Nacktheit als bei „Hair“, wo bestenfalls ein Ausdruck jugendlicher Unbekümmertheit erweckt werden soll. Johannes war ganz Neugier, verlangte Einzelheiten. He du, meinte Anita, willst du dich aufgeilen, bevor wir miteinander ins Bett gehen? Dieses Geschoß schlug tief in ihm ein, und es war ein heilsamer Schock. Einmal in Fahrt, ließ er aber nicht mehr locker: was geht wirklich in dir vor, wenn du so vorne stehst vor dem Publi-kum?
Anita lachte über die oft gehörte Frage: Ich bin ganz stark, sagte sie, und die Zuschauer sind ganz schwach. Ich bin ganz schön, und sie sind ganz häßlich. Und was immer sich ein geldgieriger Manager ausdachte an Kostümen, aus denen ich mich zu schälen hatte, und an obszönen Verrenkungen, die ich auszuführen hatte, es schmückte mich und machte mich noch schöner und noch stärker. Sowie einmal die Grenze der Nacktheit überschritten war, gab es keine weitere Grenze mehr.
Was empfindet eigentlich ihr Männer dabei, fuhr sie dann fort, ist es nicht viel besser, mit einer Frau zu schlafen als sie nur anzustarren? Klar, sagte Johannes, aber die Gefahr des Scheiterns ist unvergleichlich größer, wenn die Dimension des Verstandes und der Faktor Zeit mit ins Spiel kommen. Traurig blickte er sie an, unschlüssig und fast wie zum Gehen gewendet. Aber da müßte doch mit ein wenig Zärtlichkeit etwas zu machen sein, sagte Anita und begann, ihn zu küssen und auszuziehen. Er ließ es mit sich geschehen, setzte sich dann auf den Bettrand und beobachtete Anita, wie sie ihm eine Privatvorstellung ihrer Kunst gab. Aus der Gewohnheit, deutliche Wirkungen bei ihrem Publikum auszulösen, sah sie ihn dabei kritisch an. Was ist los mit dir? fragte sie. Wenn es nicht anders geht, fügte sie hinzu, dann reiß mich an den Haaren, schlag mich: die ärgsten Schlappschwänze kommen hoch, wenn sie gegen eine Frau tätlich werden kön-nen.
Johannes erhob sich langsam. Die Offenbarung dieses Augenblicks bedeutete: Gott ist überall und in allem. Er ging auf Anita zu, packte sie, erstmals in der Absicht, eine Frau brutal zu überwinden, und sie unterwarf sich ihm, nicht seiner Brutalität, sondern sei-nem neuentstandenen Gefühl, Glück aus dem Nichts schaffen zu können. Als ob er sie schon lange kannte, blickte er in ihr Innerstes, war er derjenige, der hinter die Grenze ihrer Entblößung vordrang in Bereiche, die nur ihm zugänglich waren. Plötzlich gab es kein Oben und Unten mehr, keinen Stärkeren und Schwächeren, er fühlte sich mit ihr als ein einziges Wesen, zu einem Sinn vereint, jenseits des sinnlosen Kampfes, den jeder einzelne für sich führt. Zu sich selbst gewandt, und im selben Augenblick hörte er das gleiche von Anita, so als ob ein einziger es gesagt hätte.
V
on unserer Parteizentrale ist es nicht weit zur Universität, vor der ich mich bei schönem Wetter gern auf eine Bank setzte. Da störte mich niemand, wenn ich mit dem Rücken zum Gebäude saß und mich philosophierend einem Problem näherte. Auch Johannes mochte anfangs hier hinter mir den Trost der Philosophie gesucht haben, oder den Ausweg einer redlichen Einzelwissenschaft. Was ihm geboten wurde, sprach nur eine niedrige Bewußtseins¬ebene in ihm an. Was allerdings in Wien sehr treffend als „den Doktor machen“ beschrieben wird, gelang ihm immerhin im Gegensatz zu mir. Zu meiner neidlosen Überraschung: denn wer immer irgendwo mitmacht, wird ab einem bestimmten Zeitpunkt gezwungen, ein Doppelleben zu führen, muß – um bestehen zu können – mit einer Vielfalt gespielter Rollen aufwarten. Ich hatte dabei anfangs weit weniger Bedenken als Johannes, wohl auch deshalb, weil mir die Gefährlichkeit indivi-dueller Anfechtung in meiner dialektisch orientierten Weltanschauung nicht so sehr be-wußt war (aber da habe ich dazugelernt!). Die Welt will betrogen sein, dachte ich da-mals, und wenn man vordergründig nichts erreicht, dann eben indirekt. Später begann ich mich zu fragen, was ich eigentlich erreichen wollte, welchen Sinn es hatte, weiter in meiner Partei zu arbeiten und damit das zu tun, was andere verlangten, ohne in Wahr-heit in irgendetwas gestaltend eingreifen zu können.
Bestand jemals die Möglichkeit, einen Apparat von innen her aufzurollen (sozusagen in Liebe den Selbsterkenntnisprozeß der Organisation fördernd)? Wir wenigen, die das für notwendig hielten, diskutierten oft darüber, lange bevor die Phalanx der 68er Generati-on ganz offiziell den vielzitierten langen Marsch durch die Institutionen antrat. Wir wa-ren bald darüber einig, daß es weniger eine Frage der Möglichkeit als der Notwendigkeit war, denn seit Jahren wurden Aggressionen gestaut, Verstandes- und Gefühlsreaktionen unterdrückt, weil nur noch die weitestgehende Passivität das bestehende System zusammenhielt. Wenn nun wieder einmal eine starke Persönlichkeit einprägsame Paro-len ausgab, würde die Menge nicht bedingungslos folgen, ungeachtet der Motive? Des-halb schon – so unsere Schlußfolgerung – und nicht nur aus purem Idealismus mußte man die Gesellschaft demokratisieren, die individuelle Verantwortung hervorheben, die Hierarchie der Verantwortungen durchschaubar machen, deshalb formulierten wir par-teiinternen Oppositionellen hinter vorgehaltener Hand das, was man draußen auf den Straßen brüllte: Alle Macht den Räten!
Wir beschäftigten uns auch genau mit dem Prager Frühling, dem Phänomen eines so-zialistischen und doch demokratischen Staates, auf der Suche nach den Grundlagen eines Systems, das den Anforderungen einer modernen Industriegesellschaft entspricht und dabei ohne gewisse Auswüchse öffentlichen Terrors auskommt. Wir suchten die stichhaltigen Argumente gegen eine Struktur, die den Teufelskreis des Selbstzwecks in sich barg, gegen eine Ordnung, die eine Deformation des Bewußtseins betreibt und gleichzeitig von diesem deformierten Bewußtsein gestaltet wird. Bevor uns klar wurde, woher unser Traum bedroht wurde (als nämlich dem Dubcek die Rote Armee mit ihren Bruderkräften dazwischenkam), lernten wir die Praxis innerparteilicher Revolution am Sturz des Stalinisten Novotny und gedachten, diese Erfahrung anzuwenden, wenn es soweit war.
Meine Freunde kannten mich als einen, der seiner Phantasie keineswegs freien Lauf ließ. Eines Tages überraschte ich sie allerdings mit der Erkenntnis, daß jeder beliebige Aberglaube noch weit hinter der Irrationalität des Alltags zurückbleibt. Ich wies sie auf die Arsenale hin, in denen Kernwaffen zur vielfachen Vernichtung der Erde lagerten: und dabei schliefen wir im allgemeinen ganz ruhig, wenn wir nicht gerade zu viel gegessen, getrunken oder geraucht hatten. Ich konnte damals die längste Zeit nicht mehr schlafen, und alles wurde sehr einleuchtend für mich. Die Perspektiven meines Lebens verschoben sich, und was Tag für Tag so wichtig gewesen war, verkleinerte sich zur Bedeutungslosigkeit. Was unmittelbar vor mir stand, war eine ungeheure Parabel, an deren unermeßlichen Enden die davonrasenden Dinge verglühten. Kleinlich-Grausames schmerzte mich: daß alle Langhaarigen in ein Arbeitslager müßten, daß man besser un-ter einer Rechts- als unter einer Linksdiktatur leben sollte, und was sonst noch aus den muffigen Abgründen näherer und fernerer Vergangenheit aufstieg. Ich wollte dem ent-gegenhalten, daß die meisten Menschen, die in der größten Katastrophe der Geschichte umkommen würden, bereits geboren waren.
Vielleicht wird es wieder besser mit ihm, hofften meine Freunde. Hätte Johannes solche Worte von mir gehört, wäre er mir wahrscheinlich um den Hals gefallen, aber ihm sagte ich das nicht. Ihm gegenüber wollte ich mein Image als harter Bursche nicht verlieren. Claudia, bei der ich diesbezüglich keine Hemmungen hatte auf dem sicheren Boden gemeinsamer Nächte, tröstete mich und ließ mich von Mal zu Mal in ihren Armen die Welt vergessen. In solchen Momenten enthielt sie sich auch jeder politischen Bemer-kung über sattgefressene Funktionäre, die der Katzenjammer enttäuschter Hoffnungen überkam.
Noch einmal, Themelis, denn das ist mir ganz wichtig: Wie kann man über die 68er reden? Ich selbst kann mir nur zwei Möglichkeiten vorstellen – das Lebensgefühl und die Perspektiven von damals nachzeichnen; oder (jetzt wohlgemerkt vom Standpunkt 30 Jahre später) als einen der vielen Irrwege des Sozialismus, wenngleich nicht den schlimmsten, interpretieren.
Aber in Österreich war das keinesfalls ein Irrweg, Herr Direktor. Viele ha-ben sehnsüchtig darauf gewartet, daß einmal durchgelüftet wird: Der Kampf gegen die „katholische Quadratur des nazistischen Kreises“ (ein Wort von Heidi Pataki, in genußvoller Verehrung zitiert!). Die Hörsaal-I-Taten der Herren Brus, Wiener, Weibel, Mühl und Kaltenbäck im Wien des Juni 1968 (von der Boulevardpresse als „Uni-Ferkelei“ bezeichnet) haben zwar eine Verteufelung der modernen Kunst als abartig und krankhaft bis zum heutigen Tag ausgelöst – aber der Aktionismus hat immerhin die gesellschaftspolitische Bedeutung künstlerischer Themen hierzulande nach oben katapultiert.
Das schätzen Sie falsch ein, Themelis. Alles Müll heutzutage, ebenso wie die internationalen Reliquien jener großen Zeit:
Che Guevara, der Held des Guerillakampfes
LSD, der Weg in die Freiheit des turn on/tune in/drop out
Rolling Stone, die Buchstabierfibel der Rockmusik
die Mao-Bibel, das Gebetbuch jedes Studenten von links bis rechts
Timothy Leary, der Prophet der mystischen Realitätsflucht
(weiland der „gefährlichste Mann der USA“)
Summerhill, die Schule zur Rettung der verlorenen Kindheit
Rudi Dutschke, der Vater des deutschen Aufstands gegen die Obrigkeit
Easy Rider, der Kultfilm der Hippie-Bewegung
Alles im Sand verlaufen.
Aber nicht Hermann Hesse – er kann nicht unmodern werden, denn seine wahre Sprengkraft gewinnt er erst, wenn die Revolutionäre auf ihre 50 zugehen.
Wir sind aber keine Revolutionäre, die auf ihre 50 zugehen, Themelis. Wir sind welche, die von der Revolution gelesen haben…
O nein!
… gelesen haben, beharrt der Verleger, als sie jung waren, und die jetzt in die Jahre kommen. Könnten Sie heute hier ruhig sitzen (auch wenn man Sie niemals erwischt hätte), wenn Sie zum Beispiel 1967 in Brüssel jenes Kaufhaus in Brand gesteckt hätten? Immerhin sind dabei gezählte 253 Menschen umgekommen. Oder wenn Sie als Angehöriger der Kommune 1 ein Flugblatt „Wann brennen die Berliner Kaufhäuser?“ veröffentlicht hätten.
Aber das war als Protest gedacht gegen die braven Bürger, die ohne Ge-fühlsregung im Fernsehen die Schreckensbilder aus Vietnam ansahen!
Was Sie aber nicht als verbalen Kraftakt abtun können: ein Jahr später gehen zwei Frankfurter Kaufhäuser in Flammen auf. Das passiert nachts, Personen kommen nicht zu Schaden. „Gewalt gegen Sachen“ wird als harmlos deklariert. Die Brandstifter werden allerdings rasch gefaßt und wegen menschengefährdender Handlungen zu schweren Zuchthausstrafen verurteilt. Zwei der Angeklagten, Gudrun Ensslin und Andreas Baader…
… übrigens typischerweise keine Studenten, sondern eine 28jährige Lehrerin und ein 32jähriger Berufsloser…
… wie auch immer, diese Kerntruppe der späten Roten Armee Fraktion tritt zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung. Anläßlich ihres Prozesses lernen die beiden die Journalistin Ulrike Meinhof kennen: eine Terrorgruppe entsteht, die sich künftig nicht mehr mit der Gewalt gegen Sachen aufhält, sondern ihre todbringende Spur zieht, auch bis zum bitteren eigenen Ende. Das sind nicht Sie, Themelis, das haben Sie wie gesagt nur gelesen, gehört, gesehen. Die Revolution verschlingt immer alles, was sie hervorbringt, und Sie Themelis, Mann, sind immerhin am Leben.
Ich bin am Leben, weil ich getötet habe. Aber das war weit weg von hier, gehört in eine andere Zeit, fast will mir scheinen, in eine andere Dimensi-on.
Der Verleger blickt stumm fragend, aber er fordert keine Erklärung.
AUS DEM LITERARISCHEN WERK DER AMÉLIE N. ALIAS „AGENT DREAM“
Dokumente einer möglichen Existenz Hrsg. von Claudia Th. unter sorgfältiger Bearbeitung
vua launga zeid
i gschbias in mia:
bevua i so a oama binkl wuan bin,
woa i a granich, wauns wisds
wos des is.
mein hois hob i in himme aufegschtregt!
wia ois endschtaundn is, des woa
a luft, in dea ka bißl greane woa.
gaunz zeidlich in da frua woas,
und i hob ka bißl gschiß ghobt,
und mei lochn woa
gaunz one gschtaunkn,
und zwischn meine zechn woa nua klassa schlaumm.
wäu: – olas was do no gschegn is, woa
gaunz unhamlich schtü.
de sunn
schena ois wia da mond mid sein auzara-liachd, schena ois wia
de brotzign schtean, vü schena ois wia
a komed mid sein schwaf –
is de sunn
– wäu jedn dog unsa lem aun ir hengt.
schene sunn, de wos aufged, owa auf gestan
ned vagessn hod: am schenstn bisd in summa,
waun a dog aum schtraund vadaumpft
und de segln
von most bameln.
one sunn haßt des ois nix – i siech di ned,
und des mea und da saund liegn
in schtaubigen schottn.
schene sunn, de uns wamt und dahoit
und vasuagt,
damid i wida siech und damid i di widasiech.
schene sunn, i schtee nix am mond
und auf de schtean
und auf de nochd, de mi
zun noan mochd –
sondan wegn dia wea i jamman, waun ma
de augn zuagengan
und nimmamea auf.
kennt sei
kennt sei
– wauns a ned zun glaum is –
das des varecken ausbleibt
das da fridn gaunz leichd
iwa uns kummd, owa
one widared
ma lesad nua in da zeidung:
vaschitt unsa schreierei, des gaunze
gequatsch umasunst
wia modiche epfe
da dod
wauns d’nochd daheazan
wia a brade blochn,
scheint da mond so koid.
am wossa, diregt untan himme
head ma singa, und in finstan woid
schted grod a oida vua an gaunz
vawochsanan grob.
des heaz von an vogl, wia a schtaa mid fedan
foids in newe, und in gros is
a gaunz glane schpua von dod.
owa mi hoit kana aus,
wäu i
vaduascht noch ana aundan zeid.
de kummt nimmamea, i bin zuanich, wüd,
owa es nuzt nix.
Fia mein lewendign bruada
Wiast jung woast, bruada, woast wia de sunn.
— leichd weida, du varuckta diamant —
Und heit host nua mea augn wia schwoaze lecha.
— leichd weida, du varuckta diamant —
Grod zwischn kindheid und eawochsnsei
hod di da eisane
stuam dawischd.
Wias olle lochn iwa di, du fremda
bleda schmee, auf den da dod woat –
— kumm, leichd weida —
Seavas, bua, seavas in da maschin!
Wo woast’n? Is scho guad,
mia kennan uns scho aus:
Woast aufm weg zu uns mid a boa extraturn,
wäu a zeidlaung deaf a jeda glaum,
das’s bei eam aundas sei wiad!
Owa jezd kumm eina:
Seavas, seavas in da maschin!
Wos ma ned griagn kau, woitast, woitst‘ in mond.
— leichd weida, du varuckta diamant —
Fua’d schottn in da nochd, do muasd di fiachdn.
— leichd weida, du varuckta diamant —
Dei schigsoi is auf di gfoin, gaunz aso
wia a blinds hendl aramoi a keandl findt.
Wias olle lochn, wäust du bütta in dia siechst,
a mola one foab und pinsl –
— kumm, leichd weida —
Seavas, bua, seavas in da maschin!
Wos hosd’n dramd? Is guad,
mia wissn, wos des woa.
Hosd dramd am weg zu uns mid fantasie,
dasd schee und reich und gscheid sei wiasd,
das’s bei dia aundas sei wiad!
Owa jezd kumm eina:
Seavas, seavas in da maschin!
(Aus „20 schlenkara noch bekaunte vuabütta“)
Diesmal fällt der Blick über die Brille lang und schweigsam aus. Gewiß doch, Themelis, nicht Ihre Worte, Sie brauchen es nicht mehr zu betonen. Aber Sie sind der einzige hier im Raum, der mir diese sprachliche Aberration erklären kann. Das ist wohl unzweifelhaft Euer Wiener Dialekt?
In Wien wurde im Lauf der Zeit alles versucht, um die künstlerisch verwendete Sprache ihrer Eigenschaft als banales Alltagsmaterial zu entkleiden. Ich finde gerade den Dialekt nicht als die schlechteste Methode, um das schockartig zu erreichen.
Das heißt, Sie verstehen das? Und es gefällt Ihnen wohl noch obendrein?
Am besten von all diesen fremden Texten, mit denen Sie mich heute immer wieder konfrontieren, Herr Direktor!
Und was bedeutet das in Normsprache?
Ist nicht Ihr Ernst, Herr Direktor! Würden Sie mich auch bitten, eines von Ihren Andy-Warhol-Objekten in eine für Sie verständliche Alltagsform zu mutieren?
Sie machen es mir nicht gerade leicht, Themelis!
Ich will Sie nur darauf hinweisen, daß Ihre Normsprache unter Metaphä-nomenen verschüttet wurde. Eines der Hauptanliegen der 68er in Öster-reich war es zum Beispiel, den latenten Faschismus zum Vorschein zu bringen. Ich denke, das ist ihnen alles in allem trefflich gelungen, in Gedanken, Worten und Werken: Schuldenerlaß für die ärmsten Länder der Dritten Welt, Arbeitslosenunterstützung, Solidarität schlechthin wurde zunehmend verpönt. Nachdem Bruno Kreisky in den 70er Jahren das rechte Lager zeitweilig ruhiggestellt hatte, gab es spätestens zehn Jahre später wieder Bürger (vor allem auch Abgeordnete), die sich die Wiedereinführung der Todesstrafe vorstellen konnten. Und daß die heimische Polizei auf dem rechten Auge blind ist, wissen wir lange – da mußte nicht erst die obrigkeitliche Duldung dafür vorliegen, die wir jetzt haben.
Ausländer raus – bevor sie jemand umbringt!?
Genau das gehört schon unter dem Rubrum der 60er Jahre erwähnt, Herr Direktor, denn von dort (von der angenehm polarisierenden Provokation der Bürger statt einer gediegenen politischen Bildung, wie es einem zivilisierten Land geziemen würde) führt der Weg zu der Mehrheit, die nach den Briefbombenanschlägen nicht primär die Täter fassen, sondern als Konsequenz die Ausländergesetze verschärft sehen wollte. Als letzte Weichenstellung im öffentlichen Bewußtsein schließlich der Tod des Marcus Omofuma (sie erinnern sich: Ersticken durch Mundverkleben während seiner Abschiebung, weil angeblich drei Beamte seiner nicht Herr werden konnten), der völlig folgenlos blieb: halbherzige Untersuchungen, jedenfalls keine Gerichtsverhandlung und schon gar keine Verurteilung.
Da kann ich mir vorstellen, daß keiner mehr aufbegehrte, auch wenn er nicht von schwarzer Hautfarbe und kein mutmaßlicher Drogendealer war: da war der Rechtsstaat eigentlich schon im Eimer.
U
m mein Bewußtsein zu erweitern, besuchte ich eine Lesung, die zuletzt zu einem Skandal wurde. Dieser nahm vom Veranstaltungsort, einer kleinen Vorstadt-Volkshochschule, seinen Ausgang und pflanzte sich bis in hohe und höchste Parteikreise fort. Allein meine Anwesenheit hat mir politisch massiv geschadet, gar nicht zu sprechen von den Kübeln voll Unrat, die über den Gastgeber und die Ausführenden seitens der Kulturfunktionäre gegossen wurden. Es gab Lyrik einer bislang ganz unbekannten Autorin, Texte von W.M., einem zumindest in unserem Kreis bekannten Homosexuellen (warum wir gerade seinen Namen niemals ohne diesen Zusatz nannten, weiß ich nicht – jedenfalls trafen einander viele von uns später bei einem seiner berühmten Feste), natürlich auch Werke arrivierter Autoren. Die Initiative ging von J.C. aus, der wohl erkannt hatte, daß er – wenn überhaupt – auf diese Weise Aufsehen erregen konnte.
Die Leselampe und die Wasserkaraffe waren an diesem Abend jedenfalls tot: eine Mo-dernisierung, die nicht nur die Oberfläche betraf. Die Gedichte und Balladen rückten ganz nahe an die arenaförmig sitzenden Zuhörer heran. Nicht alle hatten vielleicht da-mit gerechnet, daß die Papierform all dieser Literatur in einem Gestaltungskonzept wie diesem so leicht in Aktion umgesetzt werden konnte. Unter dem Motto „Die Last ruht unverstanden auf allen“ wurde gefragt, was eigentlich diese Welt sei, welcher Dynamik sie unterliege.
Der erste Teil war Längsachse: Kain bis Vietnam. Schlaglichter des Brudermordes, von der Anhörung der Mörder bis zur Annoncierung der Nachgeborenen, die Brecht um Ver-zeihung bittet. Anrufung schließlich dessen, der vielleicht alles überblickt: war er der Blinde, der den Großen Bären an der Leine hält, konnte man zu ihm sagen: „Hören Sie mal, Herr – Gott!?“ Dazu zahlreiche Querschnitte: die Fragen eines lesenden Arbeiters, eines linken Kabarettisten, eines weiblichen Irrlichts, die Feststellungen eines Handke („was ich nicht bin“) und eines Artmann („wos an weana olas auns gmiad ged“). Ferner ein skeptisches Abklopfen der Realität, der „glücklichen Welt“ ebenso wie des Miniatur-kosmos der Wiener Universität: ob denn die Wirklichkeit, die man uns vorgaukelte, ei-ner genaueren Prüfung standhalten konnte. In dieser Fülle von Ansichten stand auch etwas Unzweifelhaftes, und ich war froh, es zu entdecken, einfach Liebe: „fia d’moni“.
Der zweite Teil der Lesung folgte der Zielrichtung der Utopie: Projekte quer durch „Er-de, Meer und Himmel“ (Ingeborg Bachmann). Manche mochten das sehr konkret auf-fassen, manche mochten es so wie ich als Bilder für eine Revolution deuten und für das, was nach ihr kommt. Nunmehr belebten die Vortragenden den freien Raum in der Mitte des Forums, versuchten, über das Wortmaterial hinaus Inhalte zu vermitteln: Brechts „Was nützt die Güte?“ wurde pantomimisch unterstützt, Bachmanns „An die Sonne“ wurde kniend, „Die Sonne wärmt nicht“ am Boden liegend gesprochen. Ein Mann aus dem Publikum, dem Aussehen nach Asiate, erfüllte sogar die im Gedicht ausgesprochene Bitte „Heb mich auf“, zog J.C. empor und ergriff seine Schultern, als wollte er sagen: Nun beruhigen Sie sich aber, Mann.
Auch mich hatte der ekstatisch gehauchte Schlußsatz nicht erhoben, sondern auf den bitteren Boden der Realität geholt: daß nämlich mit dem Überschreiten jeglicher ver-nünftigen Grenze nichts zu ändern ist.
Die alte Skepsis sprang mich wieder an. Die Quellen der Spannung, unter denen die beiden Vortragenden standen, waren nicht gesellschaftskritisch, sondern pathologisch. Spannung des Spiels, des Sandkastens der Realität, fiktive Zieldefinition: das ist alles sehr in Ordnung. Aber bitte nicht diese Sehnsucht nach der Langeweile des Himmels! Wohl nahm ich den beiden das Wagnis ab, etwas real glaubhaft machen zu wollen, wohl akzeptierte ich, daß sie dem Publikum so nahe rückten, aber die gebotenen Inhalte waren in dieser Rezeption anzweifelbar
J
ohannes hatte sich inzwischen nochmals mit Sonja Maria getroffen. Am Tag vor der Lesung (ich erfuhr dies erst nachträglich als Erklärung dafür, daß meinen Freund das Ereignis in der Volkshochschule relativ gleichgültig ließ) hatte ihn Sonja Maria angerufen und gebeten, ins Kaffeehaus zu kommen. Während er ihr gegenübersaß, wuchs rasch seine Nervosität, und auf deren Höhepunkt betrat der Regierungsrat das Lokal. Er setzte sich an einen abgelegenen Tisch. Johannes machte Sonja Maria sofort das Angebot, sie mit dem anderen allein zu lassen, doch sie wollte offenbar endlich die Konfrontation der beiden Männer (hier ging Claudias Saat auf, allerdings nicht wie ge-plant). Nachdem Sonja Maria den älteren Freund an ihren Tisch gebeten hatte, schwieg sie und beobachtete Georg und Johannes. In Reaktion auf eine lange Zeit des Unver-stehens und der Herabsetzung ihrer Person, derer sich in ihren Augen beide schuldig gemacht hatten, genoß sie einen Moment weiblicher Überlegenheit, von deren Warte sie sich fragen konnte, warum gerade sie an diese beiden geraten war. Die Aufforderung Georgs (der bis dahin mit Johannes lediglich den Gruß gewechselt hatte), nun ihrerseits etwas zu sagen, beachtete sie gar nicht.
Vor Georg tat sich ein Abgrund an Komplikationen auf, die er keinesfalls im Sinn gehabt hatte, als er sich in Sonja Maria verliebt hatte. Erklären Sie mir doch, was ich machen soll, sagte er zu Johannes. Er schilderte meinem Freund, wie lange er dieses Mädel (Mädel! dachte Johannes angewidert) nun schon kannte und was er in dieser Zeit durchgemacht hätte. Aber, meinte er dann mit einer eleganten Handbewegung in Rich-tung Sonja Maria, letztlich ist sie die Leidtragende, das steht zweifellos fest. Die tiefsit-zenden Nachbeben diverser Eklats an der gemeinsamen Arbeitsstätte sollten durch die-se höfliche Lüge überdeckt werden, entgingen dem aufmerksamen Beobachter aber nicht. In diesem Augenblick erschien Georg müde und mehr als bereit, die ganze Ange-legenheit von seiner Seite wie einen Lichtschalter auszuklicken. Zugleich aber sprang ihn die Leere einer Zukunft ohne Sonja Maria an, daheim bei der Familie, ohne Ziel und ohne Hoffnung. Plötzlich wurde ihm bewußt, daß ihm dann erst recht nichts anderes übrig bleiben würde als sich scheiden zu lassen, um dieser Art Freizeit zu entgehen. Der Beruf hatte in all den Jahren ohnehin jeden tieferen Sinn verloren.
Da er diese Gedanken aber nicht laut werden ließ, drängte Johannes in die Stille hinein zum Aufbruch. Er bestand darauf, Sonja Maria nach Hause zu bringen, da ja er es ge-wesen sei, wie er ironisch bemerkte, der den Abend mit ihr verbracht hatte. Als er von Sonja Maria wegfuhr, sah er gerade den Regierungsrat, der ihnen gefolgt war, das Haus betreten. Johannes parkte seinen Wagen und wartete. Sinnlos wie die seelische Prüfung, die er sich damit auferlegte, war die Peinigung seines Körpers, der in diesen Stunden von innen zu verbrennen schien. Gegen ein Uhr morgens kam Georg wieder herunter und ging zu seinem Auto. Am erleuchteten Fenster erschien Sonja Maria wenig bekleidet und winkte. Als sie Johannes erkannte, der nun neben seinem Wagen stand und zu ihr emporstarrte, schlug sie das Fenster zu. Gegen alle Verkehrsvorschriften, mit wahnsinniger Geschwindigkeit jagte Johannes den Regierungsrat, bis es ihm gelang, zu überholen und sein Auto vor dem des anderen querzustellen.
Brave Bürger, die nach des Tages Mühen schliefen, mochten nicht wissen, daß in dieser Gegend Floridsdorfs um diese Zeit Prostituierte standen. Vor ihnen fand das Gespräch statt, das mit dem bedeutungsvollen Satz Georgs begann: Sie stören meine Kreise, lie-ber Freund! Johannes hörte unerwartet geduldig zu, als der Regierungsrat aus seinem Leben zu erzählen begann, und das, was er erfuhr, ließ ihm den Mann begreifbarer er-scheinen, fast mit einem Anflug von Sympathie. Es handelte sich offenbar um das übli-che Chaos eines, der geliebt werden wollte und nicht wußte, nein – geradezu weit da-von entfernt war zu wissen, wie ihm das jemals wirklich widerfahren könnte.
Ich liebe Sie, sagte Johannes lächelnd, obwohl Sie gerade aus dem Bett Sonja Marias gestiegen sind. Ich danke Ihnen für diese Erfahrung, die ich bisher nicht machen konn-te: jetzt weiß ich selbst das. Georg sah etwas verstört drein, stieg rasch in seinen Wa-gen und fuhr los. Die Umstehenden waren nicht bürgerlich genug, um sich überall das zu wundern.
Wie es Johannes gelungen ist, in dieser Nacht nochmals zu Sonja Maria vorzudringen, ist mir bis heute nicht ganz klar, aber er saß jedenfalls gegen drei Uhr morgens bei ihr, und sie servierte ihm Tee, und er spielte Schallplatten ab und redete wirres Zeug, das sich irgendwie aus den Lehren Anitas abzuleiten schien. Plötzlich wurde ihm wie nie zuvor bewußt, daß er nichts zu verlieren hatte. Er kniete sich vor Sonja Maria hin, machte sich zum Schein ganz klein, und sie legte ihre Hände zärtlich auf seine Schultern, in der Art einer Mutter. Er sprang auf, schlug auf sie ein und brüllte: Nachdem du heute bereits den Vergleich mit Worten hattest, biete ich dir noch den anderen Vergleich! Er schloß sie fest in die Arme, sie riß sich los, schlug auf ihn zurück, beschimpfte ihn. Er packte sie wieder, übergangslos fielen sie aufs Bett und schliefen miteinander. Gleich darauf stießen sie einander zurück und zerfleischten einander mit Haßtiraden, und dann versanken sie wieder in eine körperliche Umarmung. Sie spielten diese Tragikomödie bis zur völligen Erschöpfung. Auf Sonja Marias Gesicht lag der Schmerz von hunderttausend Jahren, als Johannes sie verließ. Sie wollte ihn zurückhalten, aber wie im Sinne einer außerhalb seiner Person befindlichen Dramatik ging er fort.
J
.C. und Johannes standen vor dem unbewohnten Haus am Stadtrand: Johannes die Hände in den Taschen, Zigarette im Mundwinkel, über seinen Zustand hinwegplaudernd. Dieser Freitag war neblig, bei verwischten Konturen weit nach oben geöffnet. Das Haus hätte genausogut auf einem Planeten der Berteigeuze im Orion stehen können, wohin Johannes sich als Kind oft gesehnt hatte. Nun hoffte er nicht mehr auf die Sterne: irgendwo innen, weitab und verlassen lag, was er suchte. Die Herausforderung war gegeben. Niemanden interessierte, daß ihm das Tier der Apokalypse begegnet war, mit dem er stundenlang gekämpft hatte, bis er in einer blutlosen Schwere sein Bewußtsein verloren hatte. Die Morgen nach solchen Nächten waren mühsam: aufstehen, weggehen, Termine einhalten, als wüßte man nichts.
Die Spannung zwischen Johannes und J.C. war unvermittelt da. Woran Johannes eben erinnert worden war, blieb ungesagt. Schon begann er sich dem Anspruch des Gefähr-ten zu verweigern, schon betrachtete er ihn als ein Relikt einer untergegangenen Zeit, mit der er nichts anzufangen wußte. Die Hoffnung, von der J.C. sprach, verwandelte sich in Langeweile, die Harmonie, die jener anstrebte, war die der Engel, die unaufhör-lich um den Thron des Allerhöchsten stehen und sein Lob singen, ein Gähnen verbergen hinter vorgehaltener Hand.
Sie betraten das Haus, und dann begann J.C. um drei Uhr nachmittags, Johannes lita-neihaft und mit gesenktem Kopf um Verzeihung zu bitten: für jede Sekunde, in der er in seiner Gegenwart gelitten hatte, nicht glücklich gewesen war, seinetwegen nicht geliebt hatte. Nie hat mich jemand verstanden, sagte J.C., nie versteht mich jemand, und nie wird mich jemand ganz verstehen: weil ich nie von dieser Welt war, nicht von ihr bin und nie ganz von ihr sein werde. Johannes empfand unangenehm die Peinlichkeit der Situation. Obwohl er sich sonst nicht scheute, jemanden zu berühren, auch nicht einen Mann, mußte er sich überwinden, J.C. an den Schultern zu fassen. Die Erfahrung, daß ein Mann ihn appetierte, konnte er nicht mehr mit innerer Ruhe durch sich hindurchlau-fen lassen. Wie J.C. in völliger Einseitigkeit sich ihm zuwandte und damit die Verantwortung für jede weitere Reaktion und jedes weitere Handeln auf ihn abschob, überforderte und reizte ihn.
An diesem feuchtkalten Freitag in Wien wurde Johannes von der langvertrauten Resig-nation erfaßt, die von rundherum unlösbaren Situationen ausging. Ein Nachhall der To-dessehnsucht seines achtzehnten Lebensjahres durchschwebte ihn: die Qual der einge-schränkten Erkenntnismöglichkeit, der Unfähigkeit, alles zu wissen, was für die Lösung eines Problems wesentlich war, der Lächerlichkeit jeder Entscheidung, die aus unvoll-kommener Sicht getroffen gleichsam sich selbst schon wieder aufhob.
Er bedauerte J.C. für dessen Selbstentblößung, obwohl das alles vielleicht nicht so deut-lich zum Vorschein kam, daß man es hätte fassen können. Um den Gefährten nicht zu verletzen, versuchte Johannes lediglich, dessen Totalitätsanspruch zurückzuweisen und ihn auf den Boden der Tatsachen zu führen. Das wäre einzigartig, wenn du wärest, was du glaubst, sagte er, aber du bist es nicht. Wenn du es wärst, könnte ich dich gar nicht ansehen, nicht mit dir sprechen, dich nicht mögen. Daß ich all das vermag, liegt daran, daß du mehr bist als dieses Gespenst, das du sein willst. Du bist ein Mensch, ein Freund, dem man die Hand hinstrecken kann, der sich an dieser Hand festhalten kann, und den man dann sicheren Schrittes vom Abgrund wegführt zurück ins Leben.
Aber J.C. stieß ihn zurück in einer Aufwallung seines paraphrenischen Bewußtseins. Der böse Geist wehrte sich dagegen, ausgetrieben zu werden, und ging zum Gegenangriff über. Du Dreckschwein, brach es aus J.C. hervor mit einer Heftigkeit, die Johannes er-zittern ließ. Von dem Haß, der aus den Augen seines Gegenübers glühte, sträubten sich ihm die Haare, und er machte sich bereit, um sein Leben zu kämpfen. Plötzlich sah er das Messer in J.C.’s Hand, und im selben Augenblick stürzte dieser auf ihn los. Johannes wog blitzschnell seine Chancen ab. Mit seiner körperlichen Überlegenheit mußte es ihm wenigstens möglich sein, dem anderen das Messer zu entreißen. Als er aber J.C. an den Handgelenken packte, sah er sich mit den Kräften eines viel größeren und stärkeren Mannes konfrontiert. Auch bei ihm selbst mobilisierte nunmehr die Todesangst alle Reserven und schaltete die Halbherzigkeit und den Zweifel seines religiös-philosophischen Überichs aus. Er schlug mit voller Wucht zu und vernahm erstmals in seinem Leben den dumpfen Ton eines getroffenen Körpers und das Rumpeln, mit dem ein bewußtlos Geschlagener zu Boden fällt.
H
in und her gerissen zwischen Welten. Die katastrophalen Geschichten von Johannes, und auf der anderen Seite Claudia, die gerade ihren Durchbruch als Unter-nehmensberaterin des Jahres feierte mit ihrem Artikel für die Zeitschrift „Programmati-scher Report”.
Programmatischer Report
WIR MÜSSEN LERNEN, SPUREN ZU LESEN
Die Entwicklung der realen Welt läuft der intellektuellen Interpretation derselben davon: es handelt sich dabei offenbar um ein Zeichen gravierender Spannungszustände der bestehenden Gesellschaftsordnung. Cha-rakteristisch für die Situation scheint vor allem zu sein, daß die politischen Gruppierungen im engeren Sinn – selbst solche, denen eine unzweifelhafte Redlichkeit unterstellt werden darf – hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Welterklärung an einem Tiefpunkt angelangt sind. Für das einzelne Wirtschaftsunternehmen, das nicht zuletzt auch als Mitspieler in der sozialen Arena agiert, hat diese Diagnose tiefgreifende Konsequenzen: Neben die übliche ökonomische Unsicherheit, in der die betriebswirtschaftlichen Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden müssen, tritt die neue Dimension einer ausgeprägten metaökonomischen Unsicherheit. Das bedeutet die Beschäftigung mit Themen, die bis jetzt normalerweise nicht Gegenstand der betriebsinternen Diskussion waren.
I.
„… contento del novecento?“
Die wesentlichen gesellschaftspolitischen Konzepte unserer abendländischen Welt (das bisherige politische Osteuropa miteingeschlossen) stammen aus einer immer ferneren Vergangenheit. Bis heute, nahezu am Ende des 20. Jahrhunderts, hat sich kein geistiges System herausgebildet, das autochton in bezug auf diese Epoche wäre bzw. adäquat wäre ihrem spezi-fischen Phänomen: der ungeheuren technologischen Expansion, in der das Instrument Technik zuletzt sogar zum Ziel des Fortschritts umgeschlagen ist. Die Verfangenheit in traditionellen Denkmustern, gepaart mit einem Handwerkszeug, das praktisch dazu ansetzt, die menschliche Natur- und Kulturgeschichte umzuschreiben, hat der bestehenden Gesellschaftsordnung ihre eigene Dynamik aufgezwungen und sie damit unter größten Streß gesetzt.
Überbevölkerung, Umweltzerstörung, Wohlstandsdiskrepanzen, Verschuldungsproblematik usw. sind unter diesem Ansatz Symptome der Spannung, nicht ihre Ursachen, wie vielfach ebenso hartnäckig wie fälschlich behauptet wird. Im Kern steht das Bestreben, ohne Rücksicht auf Nebenbedingungen und vor allem auf die zentralen Bedürfnisse des Individuums alles zu realisieren, was realisierbar ist: das Spiel, das in der Präkondition des Menschen eine Sublimation realer Erlebnisvorgänge darstellt, ist durch die Unachtsamkeit des Spielenden aus dem Sandkasten entkommen und macht die reale Welt unsicher.
Das 19. Jahrhundert symbolisiert festgefügte Ordnungen verschiedener Ausprägung, deren aufeinanderfolgende empanzipatorische Ablösung sich in unserem Jahrhundert – teilweise mit grauenerregenden Erscheinungsformen – fortgesetzt hat. Ihr Erklärungswert für die Realität unserer Zeit hat aber offenbar deutlich abgenommen. Das Problem liegt im schon angesprochenen Fehlen einer geistigen Systematik, die einer (durch die Technologie geschaffenen) faktischen Weltgesellschaft gerecht werden könnte: einer Systematik also, die den technologischen Standard an den Individualbedürfnissen – die natürlich in vielen Bereichen auch Gruppeninteressen sein werden – relativieren könnte. Damit soll nicht einer völligen Rückkehr der Zivilisation auf den Status der seit Jahrtausenden kaum veränderten Physis und Psyche des Menschen das Wort geredet werden: Das extremistische Prinzip „Zurück zur Natur“ war bereits zur Zeit seiner Formulierung lächerlich und ist es dementsprechend heute mehr denn je. Robinson Crusoe hat längst begonnen, mit den benachbarten Inseln Handel zu treiben, und es gibt keine sozialromantische Umkehr.
Der pragmatische Ansatz im Sinne eines Zurechtrückens der Relationen liegt in einer dialektischen Auflösung des Entfremdungszustandes zwi-schen dem Schöpfer der Kultur (der dabei persönlich ein Teil der Natur geblieben ist) und seiner Schöpfung (dem reinen Artefakt, das großteils anderen Gesetzmäßigkeiten folgt als die Natur). Das Instrument des Menschen als körperlich-geistiger Ganzheit im Umgang mit einer ihn physisch nicht gerade begünstigenden Natur ist nun einmal Technologie, und es geht nicht um deren Abschaffung, sondern um die Definition der Methoden und Grenzen der Technologie. Einfach dadurch, daß nicht den l’art pour l’art erzeugten Problemlösungen fiktive Problemstellungen vorangesetzt werden, sondern daß umgekehrt – wissenschaftstheoretisch und wissenschaftsethisch haltbar – die Lösungsqualität einzig und allein eine Funktion der autonom formulierten Problemstellung ist.
Da die Problemstellungen – es wäre allzu naiv, dies zu leugnen – in der Regel äußerst komplex zu sein pflegen (und zwar nicht nur wegen der Vernetzung des Systems, sondern vor allem wegen der Vielfalt der involvierten Bedürfniskategorien), ist die Formulierung von Problemen eigentlich nur in einem demokratischen Prozeß von hoher Reife möglich. Weil aber diese Bedingung nicht oder jedenfalls nicht ausreichend gewährleistet ist, stellt sie selbst bereits das erste und wichtigste Problem unserer Gesellschaft dar. Die Lösung – wie könnte es anders sein, eine Anforderung an die menschliche Technologie, im besonderen Fall an die Organisationstechnologie – liegt in einer Verbreiterung und Abflachung der bestehenden Hierarchien, gemeinsam mit Maßnahmen zur Vertiefung der demokratischen Bildung auf allen hierarchischen Ebenen: Die Sichtweise der Aufklärung (daß nämlich die Verfügungsgewalt in einem sozialen Gebilde von „unten“ nach „oben“ delegiert wird) setzt voraus, daß erstens die Delegierenden im Stand des Wissens darüber sind, was sie da tun und wie sie die Delegierten sinnvoll beauftragen und richtig kontrollieren können; und daß zweitens die Delegierten im Stand des Wissens um die längerfristigen Bedürfnisse der Delegierenden sind und daß ihre eigene Qualifikation an diesem Wissen (und nicht etwa an Wahlsiegen) zu messen ist.
Verlangen wir hier nicht zuviel? Steckt dahinter nicht schon wieder die Forderung nach dem „neuen Menschen“, dessen Praxis sich an der sprichwörtlichen grauen Theorie orientieren soll? Im Gedanken an die Opfer aller Ideologien, die ihre Dissidenten durch Exkommunikation, wirtschaftliche Vernichtung oder physische Auslöschung ausgegrenzt haben, sollten wir innehalten.
Und dennoch (der jahrtausendealte Traum): wer oder was hindert uns eigentlich daran, die Welt lebenswert zu machen? Wie kann ohne Zwang, der die Lebensqualität des einzelnen von vornherein schmälert, ein Fortschritt in diese Richtung erzielt werden? Dazu eine Beobachtung: Der Mensch, wann immer er sogar das eigene Leben zugunsten seiner Freiheit zur Disposition stellt, kann nicht unter fremde Ziele gezwungen werden. Er ist aber in der Verfolgung selbstbestimmter Ziele unter größten Entbehrungen zu Höchstleistungen fähig. Und dies gilt interessanterweise nicht nur für die Inselsituation, z.B. also für den einsamen Bergsteiger, sondern auch für Situationen, in denen Einzelegoismen gebündelt werden, d.h. auch für die ganze Seilschaft.
Das Rezept lautet: Motivation. Wo sich der Mechanismus zentralistischer Kommandostrukturen selbst unter hohem Druck auf der Stelle bewegt, weil keine Sinnvermittlung mehr möglich ist, hilft die sanfte Kraft der Motivation. Wo komplexe Situationen „dezentrale Intelligenz“ erfordern, kann diese nicht auf Befehl, sondern nur durch Überzeugungsfähigkeit geschaffen werden. Aber Vorsicht: Intelligenz denkt auch und läßt sich nicht mehr abstellen; dieser Zug fährt ohne Notbremse.
Motivation als Schlagwort findet sich in so manchem feierlich verabschiedeten Unternehmensleitbild. Wenn sie allerdings die normale Art zur Verbreitung von Ideen und Steuerungsimpulsen im Unternehmen sein soll, braucht sie die veränderte (breitere und flachere) Organisationsform, braucht sie weiters Mitarbeiter, die in der veränderten Organisationsform vollwertige und bewußte Partner sein können (und dürfen!). Und selbst das nützt noch gar nichts, wenn das Unternehmen nicht beginnt, das Bekenntnis zu diesen Prinzipien hinauszutragen in die nähere Öffentlichkeit der Geschäftspartner sowie in die große Öffentlichkeit von Staat und Gesellschaft – im Rahmen einer wohlverstandenen politischen Verantwortung, von der sich niemand ausschließen kann.
II.
„… vedo un segreto aviccinarsi qui …“
Motivation hat vor allen Dingen eine zielgerichtete, zeitliche Dimension. Das Geheimnis unseres Zeitverständnisses besteht gerade darin, daß im nächsten Augenblick, irgendwann oder schlußendlich etwas geschehen kann, was unsere Aktivitäten hinfällig macht oder gar beendet, daß wir aber ungeachtet der versiegelten Zukunft perspektivisch handeln, vergleichbar dem Steuermann, der mit seinem Schiff einem Platz jenseits des Horizonts zustrebt.
Physisch trägt der Mensch das Erbe der Primatenfamilie in sich, deren Nackenhaare sich sträuben, wenn sie sich über die Leere des Ungewissen beugen. Sein Verstand ermöglicht es ihm aber als Einzigem aus der biologischen Verwandtschaft, dieses Ungewisse durch konkrete Hypothesen operabel zu machen. Dadurch, daß es ihm gelingt, irreale (also z.B. zukünftige) Situationen als real zu definieren, sind sie auch real (d.h. beeinflußbar) in ihren Konsequenzen – man denke nur an das Phänomen der selbsterfüllenden oder selbstzerstörenden Prognose. Womit wir uns trotz dieser hervorragenden Ausstattung schwer tun, ist die ungeheure Verästelung des Geschehens, die wir selbst bewirkt haben und die auch zwangsläufig aus der Gegenwart in die Zukunft hinüberwächst.
Die zumindest teilweise undurchschaubaren Zusammenhänge scheinen vieles inoperabel zu machen, was wir theoretisch beherrschen könnten. Wer von dieser Ausgangslage her Inaktivität predigt, ist allerdings weltfremd. Denn unser aller Erfahrung ist ja Tag für Tag auch, daß alles mögliche, wenn nicht das meiste in unserem Leben ohne größeren Reflexionsaufwand funktioniert. Das liegt natürlich daran, daß wir uns eine pragmatische Anschauung der Welt zurechtgelegt haben, die fernab ist von Einsteins vierdimensionalem Raum-Zeit-Kontinuum, der bislang wahrscheinlich präzistesten Beschreibung der Struktur ebenderselben Welt. Aber abgesehen davon, daß selbst das Einstein-Modell nicht die Realität ist, sondern wieder nur ein Bild der Realität, könnten wir mit dem Bewußtsein, in einem „endlichen, aber unbegrenzten und zudem völlig instabilen Raum“ zu leben, im Alltag nicht viel anfangen. Wir schaffen uns also wie gesagt eine gröbere Annäherung.
Dabei verfallen aber viele in das andere Extrem. Wo ein gewisser argumentierbarer Reduktionismus geboten wäre, d.h. eine modellhafte Vereinfachung mit der Betonung wesentlicher und dem Verzicht auf unwesentliche Aspekte, wird radikal verkürzt auf ein quasi animistisches Weltbild, in dem aus der Sicht der Vernunft (und sogar aus der des vielzitierten Hausverstandes) völlige Ratlosigkeit herrscht, drapiert mit mehr oder weniger abergläubischen Ritualen.
Angeboren sind uns nicht die Kategorien an sich – wenn es auch manchem bequem wäre, sich ins deterministische Faulbett zu legen -, sondern allein die Fähigkeit, Kategorien zu entwickeln, mit denen wir die uns umgebende Reiz- und Informationsflut bewältigen können. Alles weitere ist „Denk-Arbeit“, der wir uns unterziehen (oder eben nicht).
Entsprechend dieser Individualverfassung gibt es eine Skala von Unternehmenskulturen, deren Extreme etwa so aussehen werden:
Das Unternehmen A handelt nach dem Prinzip der Simplifizierung. Es sieht lediglich „den Markt“ ohne jede Segmentierung. Im Tagesgeschäft tritt der eine oder andere Kunde schemenhaft hervor und verschwindet dann wieder in der Anonymität. Die Bedürfnisse des Kunden bleiben demzufolge unklar. Produktentwicklung und Marktzutritt orientieren sich an den innerbetrieblichen Gegebenheiten. Dieses instinktiv empfundene Manko versucht die eher lockere Organisationsform durch lärmende Extrovertiertheit zu ersetzen. Mittel- oder gar längerfristige Konzepte können mangels differenzierter Analyse der Vergangenheit und Gegenwart nicht erarbeitet werden. Eigentlich besteht aber auch gar kein Bedarf nach solchen Perspektiven.
Das Unternehmen B verschleißt seine Energien in der Ausarbeitung ausgefeilter Instrumente, mit denen der Markt äußerst stark differenziert wird. Wäre es technisch möglich, würde es für jeden einzelnen Kundentypus eine eigene theoretische Studie geben. Der Kunde selbst sieht sich zum Forschungsobjekt degradiert und hat den Eindruck, daß er mit seinen praktischen Anliegen fast immer ungelegen kommt. Die Produktentwicklung erhält keine klaren Vorgaben und erfolgt daher suboptimal. Der Marktzutritt findet unter großem Zögern statt. Die Organisationsform ist ausgeklügelt und wird immer wieder mit großer Liebe zum Detail verändert. Mittel- bis längerfristige Konzepte werden mit bemerkenswerter Akribie erstellt, aber wenn es um deren Umsetzung geht, erlahmt das Interesse daran.
Weder Empirismus noch Rationalismus allein können den Weg zeigen, weder der einfache Reflex auf Umfeldsignale noch die weitläufige Reflexion auf dieses Umfeld. Von beiden Positionen etwas nehmen, sich an beiden Verhaltensweisen orientieren, scheint die richtige Methode zu sein, aber wie soll man die perfekte Mischung finden?
Man könnte es Intuition nennen.
III.
„… si capiva molto poco, quasi niente, ma qualcoso si intuitiva.“
Das In-sich-Hineinhören und auch das In-die-Welt-Hineinhören gelingt individuell ganz gut, namentlich wenn man sich dazu erzogen hat, in der lauten Gegenwart auf die schwachen Signale zu reagieren, an die sich Hypothesen für die Zukunft knüpfen lassen. Wie aber kann man einem Unternehmen die Fähigkeit geben, auch als Kollektiv die Intuition zu pflegen?
Der Wert der Intuition wird heutzutage besonders vehement geleugnet: damit erfolgt eine Ausgrenzung dieser Fähigkeit aus dem seriösen Seinsbegriff. Als ob es darum ginge, das Argumentieren durch den Blick in die Kristallkugel zu ersetzen: es ist vielmehr das Fertigwerden mit einer Situation bzw. einer Entwicklung, die mit Quantitativität und Meßtechnik nicht so leicht aufzuschließen ist. Mit den herkömmlichen Instrumentarien erkennen wir Trends und sind geneigt, diese als Fortbewegungsrichtung unseres Systems zu akzeptieren. Es gibt aber unter Umständen gewaltige Oszillationen um den Trend, Ausschläge gegen den Trend, die ihn entscheidend abändern, und schließlich Trendbrüche, durch die der ur-sprüngliche Trend vernichtet wird.
Es ist eine zeitgenössishce Erkenntnis (die noch gar nicht Eingang in unser Bewußtsein gefunden hat), daß selbst solche chaotischen Prozesse ein feines Muster aufweisen. Es handelt sich dabei um keine offensichtliche Ordnung wie das, was wir im Sprachgebrauch darunter verstehen. Aber auch das Chaos scheint Ordnung zu sein, versteckte Ordnung, die sich als Aneinanderreihung von Zufällen tarnt. Intuition ist es vielleicht, wenn jemand dieses feine Muster zu erkennen vermag: durch direkte Anschauung des Objekts, ohne Blockade durch die Ratio, aber eben auch nicht völlig irrational. Und wer immer diese Fähigkeit besitzt, darf sicher sein, daß die Wissenschaft ihn nicht zu den Ihren zählt. Die Beispiele reichen vom Ignorieren der Naturheilkraft durch die Schulmedizin über die Aversion der diplomierten Techniker gegenüber dem praktischen Erfindergeist bis zum Widerwillen der Wirtschaftswissenschaft gegenüber Pionierunternehmern.
Um bei letztgenanntem Beispiel zu bleiben: Die Ansiedlung der Wirtschaftswissenschaft in der Nähe der Na-turwissenschaft statt wenigstens genau in der Mitte zwischen Natur- und Geisteswissenschaft, erweist sich aus heutiger Sicht als absoluter Fehler. Dies vor allem deshalb, weil in Österreich wie überall im deutschsprachigen Raum die völlige Trennung der Natur- und Geisteswissenschaften bereits a priori zu einer höchst überflüssigen Polarisierung beider Richtungen beigetragen hat.
Denn noch einmal: mit Reduktionismus, mit Simplifizierung kommen wir nicht weiter, wenn die entscheidenden Fragen lauten: Was kommt? Und wo? Und wann? Womit haben wir in welcher Raum- und in welcher Zeitdistanz zu rechnen?
Diese Fragen kann im Unternehmen wahrscheinlich der am besten beantworten, dessen Intuition noch intakt ist (sozusagen in einem physiologischen Sinn), aber natürlich domestiziert durch die Kenntnis und Anwendung der Betriebswirtschhaft. In Wirklichkeit ist das also kein einzelner Mensch, sondern ein Team: der Visionär, der Bürokrat, der eine oder andere weitere Typus im Spektrum. Und die müssen miteinander diskutieren, kooperieren können. Verlangen wir aber nicht, daß sie einander um den Hals fallen, das ist eben nicht drin. Der Visionär wird es dem Bürokraten nicht erlauben, seinen innersten menschlichen Code zu knacken und umgekehrt. Machen wir uns da nichts vor.
IV.
„Ancora un’altra caccia apache, la silenziosa caccia apache …“
Die Notwendigkeit zur Diskussion wird oft mit Reden-Müssen verwechselt, die Notwendigkeit der Kooperation zum Teamwork dogmatisiert. Selbst dort wo sich eine Bündelung der Interessen und Fähigkeiten nicht anbietet, wird sie mit lautem Geschrei zelebriert. Der Satz 7 des Wittgenstein’schen Tractatus logico-philosophicus (worüber man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen) deckt uns in diesem Zusammenhang einen ganzen Fächer von Kategorien auf: worüber (über welche Themen, Gefühle?) man (ich, du, wir, die anderen?) nicht (jetzt nicht, bis auf weiteres, niemals?) sprechen (sich äußern, behaupten, beurteilen?) kann (die Inhalte nicht kennend, die Worte nicht wissend?), darüber muß man schweigen (tunlichst, um leeres Gerede zu vermeiden).
Zwangsläufig fühlt man sich an die Indianer erinnert, die angeblich sagten, was zu sagen war und sonst schwiegen. Natürlich muß man vom Winnetou-Mythos abstrahieren, zu dem auch die Facette zählt, dieser edle Menschenschlag sei an der Bösartigkeit der weißen Invasoren zerbrochen. Daß sie Menschen wie du und ich waren in bezug auf Fehler und Schwächen (besonders jene, die sogenannte Hochkulturen wie die unsere hervorgebracht hatten), ist wohl kaum zu bezweifeln, aber ihrem geschichtlichen Mißerfolg gingen bei zahlreichen Indianervölkern lange Zeiträume objektiver geschichtlicher Existenz voraus, die sie im Einklang mit ihrem Lebensraum verbracht haben, ohne diesen aus dem Gleichgewicht zu bringen oder gar zu zerstören: und das ohne geistige Verkümmerung und nicht ohne alle Technologie. Jeder einzelne von ihnen war – so heißt es – in der Lage, sich auf einen Herzschlag weit an einen Bären heranzupirschen und diesen dann zu erlegen. Wenn das stimmt: welche profunde Geschäftsstrategie im Vergleich zu jener, die schon vor der Jagd das Fell des Bären am grünen Tisch verteilt!
Trotz einer Art militärischer Lebensform dürfen wir diese offenbar nicht als Begeisterung für den Kampf per se interpretie-ren (da würden wir vollends auf den Mythos der Indianerbücher hereinfallen), sondern ausschließlich vom Standpunkt der
Funktionalität. Beim Eintreten eines exogenen Ereignisses liefen definierte Prozesse ab: nach außen hin wurde die Aus-rüstung gefaßt und alle begaben sich auf die vorherbestimmten Positionen; nach innen hin begann eine fieberhafte Informationssammlung, deren Zeitmaß von den Reaktionsspielräumen bestimmt wurde. Zum hypothetischen Reaktionszeitpunkt wurde gemäß dem bis dahin vorliegenden Informationsstand gehandelt. Der Umgang mit Situationen war nicht eine Funktion des Erstaunens, sondern der flexiblen Systemerhaltung, und dies galt ebensogut für völlig außergewöhnliche Ereignisse. Man darf annehmen, daß unsere Indianer selbst beim Auftauchen fliegender Untertassen mit keiner Wimper gezuckt, sondern mit ruhiger Hand zu Pfeil und Bogen gegriffen hätten: vergleiche dazu die Reaktion gut ausgebildeter und normalerweise furchtbar cooler Finanzmanager im Zuge eines Kurssturzes an den Aktienbörsen!
Die harten Fakten von Struktur und System geben eben nicht genug Rückendeckung, wenn es ernst wird. Die Strategie, in der ich nur den Bauern auf einem Schachbrett spielen darf, wird mich nicht tragen, wenn ich Existenzangst fühle. Da ist es dann gut, auf die über lange Perioden aufgebauten und bewährten manschlichen Beziehungen der Stamm-Mannschaft zurückgreifen zu können, wo jeder um die Spezialkenntnisse (vielleicht auch Eigenheiten) des anderen weiß, wo jeder das Selbstverständnis des anderen getestet hat, wo eine gemeinsame Kultur herrscht. Ohne Kultur und ohne das Wissen, was diese aushalten kann, besitzt das Unternehmen keine zukunftsorientierten Möglichkeiten. Ohne Kultur und ohne das Wissen, was diese aushalten kann, herrscht Konfusion.
Freilich bedarf es nicht irgendeiner Kultur. Unser Unternehmen braucht ganz bestimmte Bausteine der Kultur, wenn es sich den Kunden erfolgreich nähern möchte. Rufen wir uns in Erinnerung: Der Kunde gleich welcher Branche ist heute sehr verwöhnt, sehr individuell, sehr aufgeklärt. Wenn wir dieses kapriziöse Wesen einfangen wollen, müssen wir
? lernfähig sein,
? bewerten können,
? organisieren,
? kreativ sein,
? risikobereit sein,
? kooperationsbereit und mobil sein,
? aber auch höchstpersönliches Engagement einbringen.
Vieles davon mag schlagwortartig klingen, doch diese Schlagworte verlieren sehr rasch ihr Unschärfe, wenn sie : „just in time“ realisiert werden – hier, jetzt, genau jetzt, immer wieder genau jetzt.
V.
„No si usa, no si usa piu?“
Macht man das nicht mehr? Die wehmütige, vielleicht etwas larmoyante Frage der Autorität, die sich aus bewährten Konventionen ableitet. Nein, man macht das nicht mehr so, wie wir es immer gemacht haben. Wir sind zwar physisch und psychisch die gleichen geblieben wie vor Zehntausenden von Jahren, aber alles um uns herum hat sich grundlegend verändert – nein, bleiben wir bei der Wahrheit: Wir haben alles um uns herum grundlegend verändert. Aber wie auch immer: Was vierzig oder hundert Jahre oder weiß wie lange gut genug war, ist nicht mehr gut genug.
Wir sind aber mit der gegebenen und unverrückbaren natürlichen Ausstattung geradezu prädestiniert dafür, mit neuen Situationen fertig zu werden. Wir sind, ohne uns von unserem innersten Selbst distanzieren zu müssen, Virtuosen des Abschieds oder, mit weniger Tristesse formuliert, Virtuosen des Aufbruchs – wenn wir uns nur vom Augenblick losbinden. Denn eines ist jedenfalls sicher: ein Mensch, der sich in den nächsten zehn Jahren nicht weiterentwickeln möchte, wird dann an der untersten Stelle der sozialen Leiter gelandet sein. Und ein Unternehmen, das in zehn Jahren genauso aussehen möchte wie heute, wird dann – wenn überhaupt – nur noch Gegenstand des Interesses von Wirtschaftshistorikern sein.
________
Anstelle von Zitaten die Autoren, die bei diesem Artikel Pate standen, unter anderem: Aristoteles, Nikomachische Ethik; M.D. Cohen / J.G. March / J.P. Olsen, A Garbage Can Model of Organizational Choice; P.F. Drucker, The New Realities; E.-M. Engels, Erkenntnis als Anpassung?; G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes; G. Höhler, Virtuosen des Abschieds; K. Lorenz, Das sogenannte Böse; R. Riedl, Die Folgen des Ursachendenkens; J.-J. Rousseau, Contrat Social; H. Willke, Systemtheorie.
(Motto-Zeilen aus Chansons des italienischen Interpreten Paolo Conte)
D
as war ein Fest: schwebend, rotierend, mit einem Geschmack ausgerichtet, wie ihn nur ein Homosexueller aufbringen konnte: bis hin zu den Rosenblättern, die zu vorgerückter Stunde auf uns niederrieselten. W.M. hatte auch den Asiaten von der Lesung einge-laden, dieser wieder Anita, diese Johannes: mein Freund fragte sich, ob er Eifersucht empfinden mußte, aber es war gar nicht die Gelegenheit dazu, zumal er den Regie-rungsrat auf dem Fest antraf, aber ohne Sonja Maria. Was Johannes an diesem Abend faszinierte, war die reale Möglichkeit, einfach all das zu vergessen, was vielleicht besser nie geschehen wäre. In seiner Heimatstadt Wien, in einem der inneren Bezirke, in der Wohnung eines Menschen, den er bestenfalls ein- oder zweimal gesehen hatte, lag Johannes in einer Ecke auf einer Matte und sah dem Treiben zu. Die Lautsprecher stampften und hielten das Fest in Gang. Mädchen mit exotischen Kleidern und langen Haaren schwirrten durch die Räume. Wenn er mit einer von ihnen tanzte, fühlte sie sich irgenwie künstlich an, jedenfalls verwechselbar, aber es gab auch niemanden, der auf ihre Individualität geachtet hätte: man wollte einfach etwas Weicheswarmes im Arm halten.
Was denkst du? fragte Anita Johannes. Ich denke daran, antwortete er, daß mich selbst eine Demütigung nicht heraushebt und kenntlich macht. Die Familie, der ich angehöre, kommt aus dem Nichts und geht durch mich ins Nichts. Ich bin der späte Nachfahre meiner Ahnen, deren Felder ich nicht mehr pflüge, deren Haus ich nicht mehr bewahre und deren Gräber ich verlassen habe. Wüßten sie, daß ich keine Frau und keine Kinder habe, würden sie mir fluchen: Manchmal denke ich, daß Gott aus dem Schrank fallen, unter dem Bett hervorkriechen, durch die Fenster eindringen könnte, aber ohne Eitel-keit, sondern im Einklang mit der Natur.
Ich hatte die letzten Worte mitgehört, aber bevor Anita oder ich etwas sagen konnten, holte der Inder (denn das präzise war der Ehrengast seiner Herkunft nach) seine Sitar und begann zu spielen. Immer wieder fixierte er den einen oder anderen von uns minu-tenlang mit seinen eindrucksvollen Augen. Ich fühlte, wie etwas in mir (meine Seele?) sich von meinem Körper löste und eine weite Reise antrat. Ohne daß der Inder etwas sagte, wußte ich, daß dies die erste Fähigkeit war, die er zu vermitteln vermochte: Im Geist dorthin zu gehen, wo man sein wollte, und dann den Körper nachzuziehen, wie weit auch immer, ans Ende der Welt, auf einen anderen Stern.
Als er weiterspielte, sah meine Seele etwas vor sich auftauchen, was ihr vertraut war und doch fremd, was wie ich aussah und doch wieder nicht. Ohne daß der Inder etwas sagte, wußte ich, daß dies die zweite Fähigkeit war, die er zu vermitteln vermochte: Gott zu schauen, den Zwiespältigen, Guten und Bösen, Heiteren und Traurigen, der aus dem Inneren des Menschen in die Unendlichkeit projiziert wird – ein schauriger Anblick und zugleich ein tröstlicher. In diesem Schwebezustand zwischen den Extremen verlor sich jeder Wunsch nach zielgerichtetem Handeln. Wenn ich mir in diesem Moment überhaupt noch eine Bewegung vorstellen konnte, verlief sie nicht vektorenhaft, son-dern kreis- oder wellenförmig, etwas in dieser Art.
Abrupt unterbrach der Inder sein Spiel, riß uns zurück in das Zimmer, in dem – ich wuß-te es nicht genau – unsere Körper zurückgeblieben waren, und sagte: Ihr im Westen seid doch Hohlköpfe. Ihr habt nicht begriffen, daß Gott nur nach außen glatt und allmächtig ist, nach innen hin aber zerklüftet und paralysiert im Kampf mit sich selbst. Nur im labilen Gleichgewicht zwischen den Facetten des Absoluten hängt unsere Welt, nur in der Agonie des innergöttlichen Disputs kann das Weltall bestehen, andernfalls wäre es längst zerborsten.
Er verteilte Zigaretten an uns (mein kritischer, aber sich kaum wehrender Verstand sag-te mir, daß sie nicht von der alltäglichen Marke waren) und lud uns ein, sie gemeinsam zu rauchen: Ich sah Johannes, Anita, Georg, die anderen und mich selbst mit diesen Zigaretten in der Hand, alle am Boden sitzend, die Rücken an die Wand gelehnt.
Als der Inder wieder zu spielen begann, drangen seine Gedanken erneut direkt in uns ein, ohne daß er etwas sagen mußte. Wir fliehen doch ohnehin ständig, und wir wissen nicht, wohin wir uns wenden sollen: Völlig sinnlos bleibt jede Flucht, die sich nach au-ßen richtet, würde sie uns gleich bis an den Ganges führen, damit wir dessen Wasser berühren und uns einbilden könnten, rein zu sein. Sinnlos ist jede Flucht nach außen, und würden wir gleich durch alle Städte ziehen, alles sehen, alles beachten, alles be-greifen, was mit unserem vordergründig gewordenen Sinnesapparat zu begreifen ist. Wichtiger ist es, sich nach innen zu wenden und die Kräfte zu verstehen, die in uns sind: daß wir nicht lieben können, ohne zu hassen, daß dies die Pole unseres Daseins sind, zwischen denen der Rhythmus schwingt, den wir lebendig nennen. Wichtig ist es vor allem zu verstehen, daß wir in jeder Umarmung die Erfüllung des Todes suchen als eines ewigen Glückszustandes, und daß jeder Spaziergang und jedes Gespräch und jede handwerkliche oder geistige Aktivität niemals Selbstzweck sein können, sondern nur Verzögerungen darstellen, um die Vorfreude auf die Erfüllung zu verlängern.
Wir rauchten und suchten, seinen Worten Rechnung zu tragen, indem wir einander be-rührten. Ich fühlte Anitas Hände auf meinem Körper und meine auf dem ihren. Ich sah Johannes und den Regierungsrat einander umarmen, und ich sah vieles, was losgelöst von der Situation nicht leicht wiederzugeben ist. Ich sah das Gesicht des Inders, der über sein Instrument gebeugt war, von innen her leuchten. Er als einziger berührte niemanden, wenigstens dem Anschein nach, aber seine Gedanken waren in uns allen. Ich fragte mich, ob die Abwesenheit Claudias, J.C.’s und Sonja Marias in dieser Nacht eine besondere Bewandtnis hatte, aber das war doch eher Zufall. Jeder war freiwillig gekommen, und die Anwesenden waren frei zu gehen oder zu bleiben, und das war es wohl, was den Inder von anderen Messiassen unterschied.
E
igentlich habe ich mit Claudia großes Glück gehabt (vielleicht auch sie mit mir, wenn man bedenkt, wie sehr die Mann-Frau-Beziehung angesichts der merkwürdigen Do-mestikationsmaßnahmen unserer Kultur gefährdet ist). Auf ihrem Schreibtisch sah ich im Vorbeigehen das folgende Dokument und – obwohl sonst nicht gerade neugierig – konnte ich nicht widerstehen. Theorie (das heißt für mich nur bedingt relevant)? Praxis (was bedeuten würde, daß sich mein gewohntes Leben ganz massiv ändern müßte)? Theorie (als Anleitung zur Praxis und damit als etwas noch zu Diskutierendes)? Ich wußte es nicht und ich fragte nicht – warum eigentlich fragte ich nicht? Nur weil man nicht auf anderer Leute Schreibtisch stöbert? Anderer Leute?
Aber das war ja sie – Claudia, Teil meiner selbst – ich selbst sogar in vielerlei Hinsicht. An diesem Tag entschied ich für mich, dieser Text sei nur ein Entwurf für eine Argu-mentation in einem Vortrag, einem neuen Buch womöglich…
Nachdem ich mir das Wesentliche eingeprägt hatte, ließ mich dieses Dokument nicht mehr wirklich los. Das individuelle Muster eines Menschen oder einer Beziehung, dachte ich, fast ein wenig räsonierend, kann von diesem Schema natürlich erheblich abwei-chen. Ich zum Beispiel hatte nie das Gefühl gehabt, meine Mutter flüchten zu müssen, aus praktischen Gründen jedoch vermißte ich sie sehr oft. Argumentativ hingegen war ich immer an ihrer Seite gewesen, gegen den Vater und den Rest der Welt. Vor allem aber ließ ich jeden Freund stehen, wenn sie Zeit für mich hatte, und selbst wenn nicht, blieb ich häufig allein, wie um ihr die Treue zu halten.
Claudias Mutter hingegen, wollte ich an dieser Stelle gedanklich loslegen, hielt aber inne – was wußte ich eigentlich von Claudias Mutter? Ich kannte sie ja fast gar nicht, schließlich war ich in der bürgerlichen Familie Persona non grata, einerseits trotz meiner freundschaftlichen Beziehung zum politischen Sohn, in gewisser Weise meinem Pendant bei der ÖVP, andererseits wegen meines verwegenen Verhältnisses zur Tochter des Hauses, die sich nach Meinung ihrer Eltern in unwürdigster Weise an mich weggeworfen hatte. Als ob nicht das Psychologie-Studium allein schon schlimm genug gewesen wäre: Hochschulbildung für Mädchen, meinte Claudias Vater, na meinetwegen, aber dann doch nicht das!
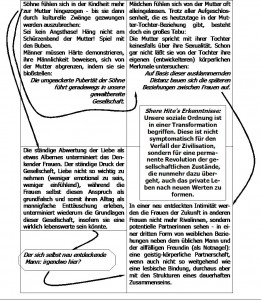
Eine eigene Meinung der Mutter war mit freiem Auge nicht zu erkennen, und das warf ihr die Tochter vehement vor, aber solche Attacken zählten wohl eher zur zwischenfrau-lichen Dimension. Mehr noch störte Claudia der kriegsähnliche Zustand der beiden El-ternteile, wobei das Arsenal der Mutter – erlaubt waren in diesem feinen Haus nur subti-le Waffen jenseits der physischen Gewalt – dem des Vaters haushoch überlegen war. Was willst du? fragte ich Claudia. Nachdem sie Jahrhunderte in einer ökonomischen Abhängigkeit innerhalb des patriarchalischen Systems gelebt hatten, wurde einer gro-ßen Zahl von Frauen erfolgreich suggeriert, daß sie bereits dann ein prostituiertenhaftes Verhalten an den Tag legten, wenn sie ihren Männern das Zusammenleben mit ihnen zu schön machten.
Angewandte marxistische Psychologie? ätzte Claudia, und ich konnte nur mit Mühe ernst bleiben: Der Marxismus, dozierte ich, ist kein Gedankengebäude, in dem deine Wissenschaft irgendeinen Platz hat. Wir brauchen – anders als der Kapitalismus – keine Neurosenmechaniker, denn in einer gerechten Gesellschaft wird es keine Bewußtseins-deformationen geben.
Siehe die russischen Babuschkas, die arbeiten wie die Tiere, um den stets besoffenen Lebensgefährten und die Kinderschar durchzubringen!
Meine Güte, Rußland, versetzte ich, was kommst du mir mit dem Holzhammerargument des irrtümlicherweise irgendwo in einem zurückgebliebenen Agrarland real existierenden Sozialismus? Marx, meine Liebe, ist auch heute noch Utopie, genau wie vor 100 Jahren, entgegen allen anderslautenden Behauptungen, und er wird erst aktuell sein (wer weiß, ob wir es erleben), wenn der Kommunismus, so wie er heute ist, zusammengebrochen sein wird und das westliche System ungehindert und unverhüllt zur vollen Entfaltung kommt. Dann werden die riesigen Wirtschaftskonglomerate entstehen, die den Menschen so weit versklaven, daß die wahre proletarische Revolution ausbricht.
Du spinnst komplett, war Claudias erste Reaktion, aber dann, nach einigen Tagen des Nachdenkens, kam sie darauf zurück und gab mir irgendwie recht, obwohl sie einräum-te, daß ihr das ganze Thema nicht wirklich ein Anliegen sei. Der Inhaltsentwurf (richtig geraten, es waren offenkundig die Vorarbeiten zu einem Buch!), den ich wieder einige Zeit später bei Claudia herumliegen sah, zeigte mir ihre wahren Interessen auf, berührte mich aber auch auf eigenartige Weise. Wie war es möglich, Theorie und konkrete Beziehung so weit voneinander zu trennen, daß objektiv lesbare Information dabei her-auskam?
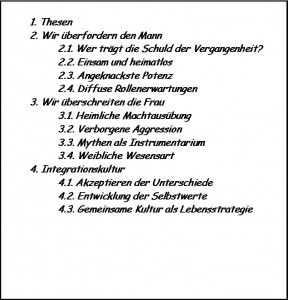
D
ie einzige Person, die Johannes‘ letzte Stunde miterlebte, war Anita. Wie sie berichtete, sei sie mit ihm spazieren gegangen, eigentlich widerwillig, denn dies war nicht ihre liebste Freizeitbeschäftigung. Er hatte davon gesprochen, wie ungeheuer belastend selbst alltägliche Dinge ihm erschienen, wenn rundherum nichts mehr in Ordnung sei. Als Anita ihm gerade eine ihrer schnoddrigen Antworten geben wollte (die ihm sicher gut getan hätte: Mensch, bleib auf’m Teppich), kamen sie an einer Kirche vorbei, und Johannes bat sie, mit ihm eine Weile einzutreten. Drinnen fiel er einfach um. Anita beugte sich über ihn, fast wie damals in der Disco, und er flüsterte ihr etwas zu. Ein Priester eilte aus dem Beichtstuhl herbei, überblickte kurz die Situation. Wie sich alles weitere abgespielt hatte, konnte sich Anita nicht mehr genau erinnern, nur daran, daß es sehr schnell ging: daß man Johannes wegbrachte und sie stehen ließ.
Nach ihrem Bericht übergab sie mir ein Schriftstück, das sie an sich genommen hatte, verabschiedete sich, und ich habe sie vorerst nicht wiedergesehen.
Ich las: Sich zum Künstlertum zu bekennen, ist weniger eine Frage des Talents als vielmehr des Mutes. Welche unabsehbaren Folgen hat es, Künstler zu sein, also den ursprünglichsten Beruf des Menschen zu ergreifen: den des Schöpfers, des Magiers. Über welchen Abgrund setzt man seinen Fuß hinweg, wenn man diese eigentlich göttli-che Beschäftigung usurpiert. Welche Erweiterung der Erkenntnis bedeutet es, wenn man folgerichtig scheitert auf dem Weg zur Vollkommenheit des Geschaffenen. Welcher Einblick in die Psyche Gottes, vor der man die Augen schließen möchte: vor dem Riß nämlich, der im göttlichen Wesen zwischen Gut und Böse klafft, unüberbrückbar nach menschlichen Maßstäben und doch vereinigt in einer einzigen Wesenheit. Da fehlt jeder Kompromiß, jede Möglichkeit diplomatischen Verhaltens, jede Chance zur Vermittlung oder Beschwichtigung.
Wieviel Ausschweifung ist nötig, um den Sinn der Askese verstehen zu können. Wie sehr muß man sich der Versuchung hingeben, um sie kennenzulernen. Wie unglücklich muß man sein, um glücklich sein zu können. Wie sehr muß man dienen, um zu empfangen. Wieviel nimmt man aber auch, um zu geben. Wo der Sturm der großen Tiefe weht, gibt es keinen Trost. Außer den gestörten und zerhackten Botschaften ist dort nur noch das Schweigen Gottes (der Natur? des kollektiven Unbewußten?).
Der letzte Schritt besteht in der Frage, ob nicht diese Begriffe etwas umschreiben, was es nicht gibt, ob sie nur eine künstliche Hoffnung bezeichnen in diesem Spalt zwischen Sein und Nichtsein. Bin ich noch fern der Wahrheit, wenn ich mich als vorübergehendes Vehikel der Evolution begreife? Sitzen wir mit unserer menschlichen Entwicklungsge-schichte trotz dieses unvergleichlich scheinenden Organs, mit dem wir das alles zu den-ken vermögen, auf einem Ast, den die Natur bereits abzusägen beginnt?
Hätten wir die Liebe nicht, wären wir tatsächlich das Schilfrohr im Wind, von dem ge-schrieben steht. Da wir sie aber haben, ist sie der eigentliche Name unserer Hoffnung, und wir können sinnvollerweise nichts anderes tun als auf allen Ebenen unseres Seins zu lieben. Nichts anderes gibt dem vorgezeichneten Untergang mehr Sinn als das Sinnlose der Liebe: in nichts berühren einander Werden und Vergehen so hautnah. Nichts anderes stellt die Verbindung her zwischen Wohlbefinden und Verzweiflung, macht uns frei von der alles zerstörenden Rücksicht auf eine spätere Rechtfertigung. Daß meine Identität aufrecht bleibt, daß alles sich – wo immer auch die Realität ist – in meinem Bewußtseins-Kontinuum abspielt, ist wesentlich: wir sterben so lange, bis wir tot sind, oder wie Pavese es gesagt hat, der Tod wird kommen und deine Augen haben. Ich kann gar nichts dagegen machen: kaum stehe ich irgendwo und blicke hinab, stürzt mir der Erdboden entgegen –
Der ist noch schlimmer als andere, dachte ich. Der besitzt den Mechanismus gar nicht, mit wir anderen die Todessehnsucht zurückdrängen. Welche Schlüsse der aus dem Leben zieht, die sind gar nicht drin. Der hat nicht nur eine dünne, sondern gar keine Haut: eine Mißgeburt.
Ich zeigte das Papier Claudia, die ebenso empfand wie ich, aber an diesem Abend mochte sie mich nicht trösten. Was wissen wir von den unzähligen Namen Gottes, sagte sie, als wäre sie bei dem Fest dabeigewesen, hätte die Worte des Inders gehört.
Protokoll Nr. 3
Insaße Nr. 4432/280147
Früher war ich noch gut drauf, sagt der Inder. Jetzt bin ich einfach schon furchtbar alt, auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht. Und wo ist das Instrument, die Sitar? Das ist es eben, antwortet er, ich bin geradezu amputiert ohne sie. Sie ist weg, irgend-wo in diesem Chaos, wer weiß. Wir haben zwar verschiedene Fähigkeiten, das stimmt, aber es gibt sozusagen materielle Verankerungen für unsere Spiritualität. Hätte ich mei-ne Sitar noch, könnte ich uns einfach hier wegspielen, auf irgendeinen Planeten irgend-einer Sonne oder auf irgendeinen Kometen, der durch eine märchenhafte Nacht jenseits von hier seine Bahn zieht.
Durch den Körper geht ein Ruck, als wolle man abheben, nachgezogen von der Seele, die schon unterwegs ist zu dem geschilderten Ort, aber dann ist man doch weiterhin da, und er ist da und sieht nun wirklich sehr alt aus von der offensichtlichen Anstrengung, die er aufgewendet hat. Wenn es nicht geklappt hat, sagt er, fühlt man sich natürlich noch elender als zuvor. Darum wäre es besser gewesen, in der vorherigen Hoff-nungslosigkeit zu bleiben.
Was ist mit dem Computer, den du gefunden hast? fragt er nach einer langen Weile. Gar nichts, antwortet man, zuerst hatte er noch Power, aber auf dem Schirm standen nur die Worte „Parity Check“, das ist eine ganz verzweifelte Botschaft. Sie bedeutet, daß er versucht, seine innere Organisation wieder aufzubauen, aber er schafft es nicht. Auf Versuche, ihm zu helfen, sprach er nicht an, immer nur diese beiden Worte, und dann erlosch der Monitor völlig. Was hätte er uns auch geben können?
Vielleicht Übersichten, Pläne, Simulationen. Aber nein, sagt man, das sind letzlich Schönwettermaschinen. Wenn du selbst noch weiterweißt, kannst du dich vervielfachen, beschleunigen, was immer. Aber so wie wir dastehen, nützt das alles nichts.
Der Steinblock, auf dem der Computer steht, sagt man – wieder nach einer langen Weile -, ist doch offensichtlich ein uralter Altar. Wenn man vor diesen hintritt, die Hände auf ihn legt, sich konzentriert auf die Wünsche, die Gebete, die Flüche, die Vorstellungen von einer trans-zendierten Welt, müßte man doch etwas bewirken können. Aber was? fragt der Inder. Was soll passieren?
{
Ich glaube fast, hier muß ich mich noch einmal einschalten, denn der Text kommt mir bis jetzt ein wenig zu geordnet daher – als würde das Schema der Begriffswelt, in das man die Wörter unserer Sprache bis in die letzte Schublade korrekt einsortieren kann, tatsächlich existieren. Mir geht es aber am Ende darum, zu zeigen, daß wir mit zufälligen Buchstabenkombinationen leben, daher auch mit zufälligen Anfangsbuchstaben, und so ist wohl nicht mehr möglich als eine lexikalische Aufzählung.
Worum es mir noch geht: ich möchte die Existenz aufspüren, und zwar ohne schon jetzt irgendwelchen metaphysischen Erfahrungen vorzugreifen, die in dieser Geschichte von manchen gemacht werden sollen. Nehmen wir daher als Beispiel die Traumzeit der Aborigines, weil diese hier gar keine Rolle spielen werden, trotz ihrer überragenden Bedeutung für die Seinsgeschichte (übrigens ein Terminus, der in dem schlauen Organigramm fehlt!).
Wer (wie etwa meine liebe Freundin ADH) je einen Beweis dafür gesucht hät-te, daß die abendländische Tradition gründlich schiefgelaufen ist, der sollte sich mit den geisterhaften Ahnen ausei-nandersetzen, die den Kosmos der Ur-einwohner Australiens geschaffen haben und die im Bewußtsein der Koori – das heißt „Menschen“, denn so bezeichnen sie sich in einer ihrer vielen Sprachen selbst, in Abgrenzung zu uns – bis heute allgegenwärtig sind. Dann müßte man sich auch nicht darüber wundern, daß zu dieser Seinsweise die praktizierte Telepathie als alltägliche Kulturtechnik gehört. Ist es nicht Grund genug für uns, das eigene Leben zu überdenken, wenn wir wissen, daß einer von denen diesen oder jenen unserer Gedanken (auch über riesige Distanzen) auffangen könnte, um dann in stummer Frage zu verharren: wie denn das nur möglich sei? Wie denn jemand seine Wesenheit derart vernachlässigen könne statt im Gegenteil zu neuen Horizonten seiner Entität inner- und außerhalb des vordergründigen Raumes sowie der vordergründigen Zeit vorzustoßen?
Altjiranga Ngambakala bedeutet in einem der Aborigines-Idiome die Eigenschaft, Metaphysisches zu sehen oder zu träumen, und beschreibt eindrucksvoll, daß die Schöpfungszeit nicht nur eine mythische, lange zurückliegende Epoche ist, sondern gleichzeitig einen aktuellen, nach Aktivität verlangenden Aspekt aufweist. Wenn man die lebendige Verbindung mit der Traumzeit sucht (was in unserer Kultur als abwegig, kindisch und schlechthin unsinnig abgetan wird), kann man bereits zu Lebzeiten einen gewissen Zugang zu den sogenannten ewigen Dingen finden. Der Geist muß allerdings dazu fähig (vielleicht geboren, jedenfalls aber ausgebildet) sein.
Ebensowenig wie ich in meinem Kopf (mit Leibniz dort herumspazierend wie in einer Mühle) dem Denken begegnen kann, erschließen sich mir anstandslos jene Fähigkeiten. Sich zu einem oder ei-ner Walemira Talmai, einem Mann oder einer Frau, dem/der das Wissen weiter-gegeben wurde, zu entwickeln, bedeutet noch mehr Selbstüberwindung, als bei den generellen, für alle Mitglieder der Gesellschaft gültigen Initiationsriten, und die sind extrem genug mit feierlich-ekstatischer Defloration beziehungsweise Circumcision, begleitet vom magischen Geräusch der Didgeridoos. So muß es aber auch sein, denn welche Voraussetzungen haben wohl für einen Beruf zu gelten, der in den Maßstäben unserer Breiten Arzt, Priester, Philosoph, Sozialarbeiter, Psychologe, Psychiater und politischer Demagoge in Personalunion wäre.
Worauf ich hinauswill? Sag den Leuten jetzt bloß nicht, daß es mehr Dinge zwi-schen Himmel und Erde und so weiter, warnt mich Annette. Keine Angst, beruhige ich sie, ich will nur unseren Lebensstil relativieren, dieses eine Menge Wirklichkeit ausschließende Sein. Das ist schon besser, lobt ADH, und vergiß auch nicht jenes Sein, das nur noch aus den banalsten Wirklichkeiten besteht. Dafür sollten wir uns jedenfalls ein wenig schämen (insbesondere für die grinsenden Politiker, den Musikantenstadel, die TV-Quizsen-dungen, den dumpfen Haß, vielleicht sogar für ein höheres Wesen, das aus uns etwas anderes gemacht hat als jene geisterhaften Schöpfer) — selbst dann, wenn wir es nicht so weit treiben wollen, an einem Walkabout teilzunehmen.
}